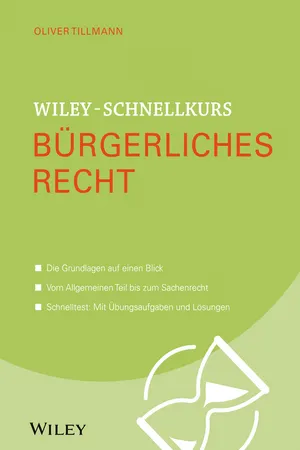
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Wiley-Schnellkurs Bürgerliches Recht
Über dieses Buch
Im Studium kommen Sie am Bürgerlichen Recht kaum vorbei und das zu Recht: Es ist eben nunmal wichtig. Oliver Tillmann erklärt Ihnen die Systematik des BGB und was Sie zum Allgemeinen Teil wissen sollten. Hier erfahren Sie, das Wichtigste zu Willenserklärungen, Verträge, Stellvertretung, Rechts- und Geschäftsfähigkeit. Außerdem führt er Sie in das Schuldrecht und das Sachenrecht ein. Kursorisch streift er gegen Ende des Buches auch noch das Familien- und Erbrecht. Zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungen helfen Ihnen, Ihr Wissen zu testen und zu festigen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Wiley-Schnellkurs Bürgerliches Recht von Oliver Tillmann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Zivilrecht. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1
Grundlagen zum Zivilrecht
In diesem Kapitel...
- Gerichtsverfahren
- Fallbearbeitung
- Gesetzessystematik
Im Alltag werden wir ständig mit vielen Regeln konfrontiert: Minderjährige dürfen keinen Alkohol kaufen, beim Fahrradfahren müssen wir die Straßenverkehrsordnung einhalten, dem Vermieter müssen wir die Miete und dem Staat die Steuern zahlen, um ein paar alltägliche Beispiele zu nennen. Die Missachtung der Regeln hat ganz unterschiedliche Konsequenzen. Manchmal hat der Staat ein eigenes Interesse an der Durchsetzung der Regeln. Das geschieht dann mithilfe von Behörden, Polizei und Staatsanwaltschaft. Andere Regeln können nur von Privatpersonen durchgesetzt werden. Diese müssen dann selbst – häufig mithilfe eines Rechtsanwalts – die andere Partei vor Gericht verklagen. Je nach Interessenlage lässt sich unser Recht in zwei Kategorien einteilen:
- Privatrecht
- Öffentliches Recht
In diesem Buch geht es um das Bürgerliche Recht. Das Bürgerliche Gesetzbuch (kurz: BGB) ist ein Teil des Zivilrechts, auch Privatrecht genannt. Das Privatrecht beinhaltet Regelungen zu den Rechtsbeziehungen zwischen gleichgeordneten Personen, kurz: das Verhältnis von Rechtsteilnehmern untereinander. Im Streitfall stehen sich beide Seiten auf Augenhöhe gegenüber und müssen sich an identische Spielregeln halten.
Dem gegenüber steht das Öffentliche Recht. Dieses regelt die Rechtsbeziehung des Staats zum Bürger. Es geht um ein Über- und Unterordnungsverhältnis, bei dem der „starke“ Staat dem „schwachen“ Bürger Pflichten auferlegt oder Rechte zubilligt. Da die Parteien nicht auf Augenhöhe verhandeln, müssen Gesetze dafür Sorge tragen, dass den Rechten des Bürgers gegenüber dem Staat angemessen Rechnung getragen wird.
| Privatrecht/Zivilrecht | Öffentliches Recht |
| Bürgerliches Recht | Strafrecht |
| Handels- und Gesellschaftsrecht | Verwaltungsrecht (Baurecht, Polizeirecht etc.) |
| Arbeitsrecht | Steuerrecht |
| Urheberrecht | Sozialrecht |
Tabelle 1.1 Beispiele zum Privatrecht und Öffentlichen Recht
Nicht immer, wenn der Staat im Spiel ist, handelt es sich um Öffentliches Recht. Handelt er als Vertragspartner, gilt auch hier das Zivilrecht, sodass z. B. bei einem Grundstückskauf durch die Gemeinde das BGB anwendbar ist.
BEISPIEL
Der Betrüger Bertram (B) verkauft dem leichtgläubigen Lothar (L) für 1 Mio. Euro einen „echten“ Picasso, den er in Wirklichkeit selbst gemalt hat. Nachdem er erwischt wurde, fragt sich B, mit welchen Gerichtsverfahren er zu rechnen hat.
1. Strafrechtliche Aspekte: Zunächst hat B mit dem Verkauf gegen § 263 StGB verstoßen und einen Betrug begangen. Die Staatsanwaltschaft wird also (nachdem sie davon durch Anzeige Kenntnis erlangt hat) Ermittlungen aufnehmen und B, wenn die Indizien ausreichen, anklagen. Am Ende könnte dann eine Geld- oder Freiheitsstrafe stehen. Hierbei geht es allein um den Strafanspruch des Staats. Bei der Bemessung der Strafe spielt auch die persönliche Schuld (z. B. „schwere Kindheit“ etc.) eine Rolle.
2. Zivilrechtliche Aspekte: Daneben könnte auch der L den B verklagen. Schließlich hat er ihm 1 Mio. Euro gezahlt und möchte das Geld nun gern wiederhaben. Das erhält er aber nicht automatisch, selbst wenn B im Strafprozess für schuldig befunden wird. Er muss dafür selbst vor dem Zivilgericht klagen und seinen Anspruch geltend machen. Hierbei steht ihm dann der B als Partei (Beklagter) gegenüber. Sein Geld erhält der L nur dann zurück, wenn die aus dem BGB geltend gemachten Ansprüche auch bestehen. Dafür gelten die zivilprozessualen Regelungen zur Beweislast. Der L müsste in dem Prozess beweisen, dass der B ihn betrogen hat, obwohl dies schon in dem Strafprozess erfolgt ist. Das Gericht kann aber die Akten aus dem Strafprozess beiziehen und diese als Grundlage für das Zivilverfahren verwerten, um die Tatsachenfindung zu erleichtern.
Gerichte und Durchsetzung des Rechts
Das deutsche Recht bestimmt für den Streitfall die Zuständigkeit der Judikative. Die Bundesländer unterhalten verschiedene Gerichtsbarkeiten, der Bund ist für die höchsten Gerichtsbarkeiten zuständig. Aus historischen Gründen unterscheidet man zwischen der sogenannten „ordentlichen Gerichtsbarkeit“ und den „Fachgerichten“ (bitte nicht „unordentliche“ Gerichte nennen).
Die Zuständigkeit der Gerichte
Zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehören:
- Zivilgerichte
- Strafgerichte
Zur Fachgerichtsbarkeit gehören:
- Arbeitsgerichte (arbeitsrechtliche Streitigkeiten)
- Sozialgerichte (sozialrechtliche Ansprüche)
- Verwaltungsgerichte (allgemeines Verwaltungsrecht, z. B. Baurecht)
- Finanzgerichte (Steuerstreitigkeiten mit dem Finanzamt)
Das Bundesverfassungsgericht ist nicht die oberste Instanz, sondern eigenständiges oberstes Bundesorgan, das ausschließlich über Verfassungsverstöße des Staats befindet.
Wenn es um zivilrechtliche (abgesehen von arbeitsrechtlichen) Streitigkeiten geht, sind die Zivilgerichte zuständig. Hier richtet sich die Zuständigkeit gem. §§ 22 ff. Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Regel nach der Sache oder nach dem Streitwert:
- Amtsgericht (Einzelrichter)
- Streitwert bis 5.000 Euro
- Mietsachen (unabhängig vom Streitwert)
- Familiensachen (unabhängig vom Streitwert)
- Landgericht (grundsätzlich Zivilkammer mit drei Richtern)
- Streitwert über 5.000 Euro (außer Miet- und Familiensachen)
- Berufungsverfahren (erste Instanz: Amtsgericht)
- Oberlandesgericht (grds. Zivilsenat mit drei Richtern)
- Berufungsverfahren (erste Instanz: Landgericht)
- Revisionsverfahren (erste Instanz: Amtsgericht, zweite Instanz: Landgericht)
- Bundesgerichtshof (Zivilsenat mit fünf Richtern)
- Revisionsverfahren (erste Instanz: Landgericht, zweite Instanz: Oberlandesgericht)
Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich die unterlegene Partei an die nächsthöhere Instanz wenden. Dabei wird in der Regel im Rahmen der Berufung das komplette Verfahren (inklusive Beweiserhebung) wiederholt. Der nächste Schritt wäre dann die Revision. Die Revisionsinstanz überprüft dabei das angefochtene Urteil nur auf rechtliche und Verfahrensfehler. Der Sachverhalt wird durch das Revisionsgericht nicht erneut ermittelt.
Das typische Gerichtsverfahren und Folgerungen für die Klausur
Zum Verständnis des Zivilrechts soll der Ablauf eines streitigen Verfahrens anhand eines Beispiels beschrieben werden.
BEISPIEL
Der 70-jährige Veit (V) wird bei seinem abendlichen Spaziergang auf dem Gehweg vom Fahrradfahrer Blötsch (B) angefahren, der gerade mit dem Handy beschäftigt war und nicht aufgepasst hatte. Dabei fällt die Brille des V auf den Boden und wird zerstört (Schaden 200 Euro). Der Student Zack (Z) fuhr mit seinem Fahrrad zufällig hinter B und beobachtet den Vorfall. V verlangt von B nun 200 Euro für die Brille. Da B aber nicht zahlen möchte, fragt V den Rechtsanwalt Anton (A) um Rat.
Vorüberlegungen: A überlegt zuerst, ob eine Klage überhaupt erfolgreich sein kann. Dies wäre der Fall, wenn eine gesetzliche Anspruchsgrundlage dem V einen Anspruch auf Schadensersatz zubilligen würde. Idealerweise würde also im Gesetz stehen: „Wer einen anderen bei einer Schönheitsoperation völlig unnatürlich aussehen lässt, ist ihm zum Schadensersatz verpflichtet“. So konkret ist das Gesetz aber natürlich nicht. Nach einigem Blättern im BGB findet A aber den § 823 Abs. 1 BGB: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
Nun muss A prüfen, ob die Voraussetzungen in der Anspruchsgrundlage auch im konkreten Fall erfüllt sind. Es muss zunächst ein Rechtsgut des V durch den B verletzt worden sein. Das ist hier der Fall, denn mit der Brille ist das Eigentum des V zerstört worden. In § 823 BGB ist auch erwähnt, dass der Anspruchsgegner „widerrechtlich“ gehandelt haben muss. Dies ist grundsätzlich bei allen Rechtsgutsverletzungen so, es sei denn, es liegt ein besonderer Rechtfertigungsgrund (z. B. Notwehr) vor. Der ist hier aber nicht erkennbar. Letztlich setzt das Gesetz noch voraus, dass die Rechtsgutverletzung „vorsätzlich oder fahrlässig“ erfolgte. Im vorliegenden Fall hat B während der Fahrt mit dem Handy gespielt, was wohl zumindest fahrlässig sein dürfte.
Klageschrift: V erhebt gegen B Klage vor dem zuständigen Amtsgericht (Streitwert ist geringer als 5.000 Euro). Die Erhebung der Klage erfolgt durch eine weitgehend formalisierte Klageschrift, in der die Forderung gestellt und anschließend begründet wird. Dabei sind Behauptungen zu beweisen, bzw. ein Beweis ist anzubieten (Zeugenaussage, Gutachter etc.). In dieser Klageschrift führt V im Beispielsfall aus, dass B ihn mit dem Fahrrad rechtswidrig und fahrlässig angefahren hat und dadurch seine Brille zerstört wurde, die einen Wert von 200 Euro hat. Jede Behauptung unterlegt der V mit einem Beweisangebot. So kann er für den Nachweis des äußeren Geschehensablaufs beispielsweise den Zeugen Z benennen. Den Wert der Brille kann er durch die Rechnung belegen. Und hat der von V geschilderte Sachverhalt ergeben, dass die Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage (hier § 823 Abs. 1 BGB) erfüllt sind, ist die Klage schlüssig. Dann geht es in die nächste Runde, in der sich der Beklagte zu dem Vorwurf äußern kann.
Klageerwiderung: B wird die Klageschrift über das Gericht zugestellt. Er kann – wenn er möchte – einen Anwalt suchen und dann innerhalb einer bestimmten Frist in einer Klageerwiderung dazu Stellung nehmen. In unserem Fall bestreitet er, den V berührt zu haben. Unterstellt man, dass der Vortrag des B stimmt, dann bestünde kein Anspruch des V. Denn wenn er den V nicht angefahren hat, ist sein Verhalten nicht ursächlich für den Schaden an der Brille.
Urteilsfindung durch das Gericht: Der Richter schaut sich nun die Äußerungen der Parteien an und prüft, von welchem Sa...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelei
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Einföhrung
- 1 Grundlagen zum Zivilrecht
- 2 Die Willenserklärung
- 3 Der Vertrag
- 4 Erlöschen von Ansprüchen und Durchsetzungshindernisse
- 5 Schadensersatz und Leistungsstörungen, §§ 280 ff. BGB
- 6 Kaufrecht, §§ 433 ff. BGB
- 7 Bereicherungs- und Deliktsrecht
- 8 Sachenrecht
- 9 Grundbegriffe des Familien- und Erbrechts
- 10 Überblick über das Handels- und Gesellschaftsrecht
- Lösungen zu den Übungsfällen
- Stichwortverzeichnis
- Wiley End User License Agreement