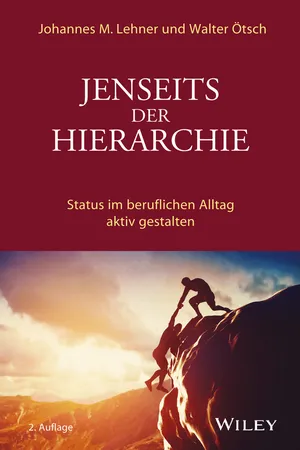![]()
1 Soziales Kapital: Status, Hierarchie und Macht
Statusverhalten und Statusspiele
Dominanz und Unterordnung sind notwendige Elemente jeder Kommunikation – und zugleich die größten Tabus. Normalerweise sprechen wir nicht darüber, wie uns andere einschränken und kontrollieren, unsere Kreativität und unseren Ausdruck hemmen – und wie wir dies mit anderen tun. Meist wird uns das nicht einmal bewusst. Nur bei schweren Konflikten platzt es manchmal heraus: »Sie akzeptieren mich nicht.« »Dauernd stellst du dich über mich.« »Sie halten sich wohl für etwas Besseres.« Dieses Buch handelt davon, wie wir uns im Alltag über- und unterordnen, wie wir uns positionieren, wie wir uns über andere erheben oder ihnen untertan sind, wie wir ignorieren, demütigen, erniedrigen, erhöhen: andere mit uns und wir mit ihnen.
Immer wenn zwei oder mehrere Personen miteinander zu tun haben, werden Macht, Einfluss und soziales Gewicht verteilt: Wer hat in der aktuellen Situation mehr zu sagen, wer kann sich Gehör verschaffen, wer setzt sich durch und wem wird etwas aufgedrückt? Wer ist eher aktiv oder passiv, bestimmend oder hinnehmend? Wer setzt die Akzente und wer fühlt sich eingeengt? All diese Dinge geschehen – unmerklich die ganze Zeit, in beinahe jeder Interaktion, in jedem Satz, in kleinsten Gesten. Das wollen wir in vielen Details beschreiben. Wenn zwei Menschen miteinander reden, dann geht es auch – ob sie es wollen oder nicht – um ihre Position, um ihren aktuellen Einfluss. Stellen wir uns vor, wir könnten ihr soziales Gewicht in jedem Moment mit einer Waage messen. Sie ist – wenn wir genau hinsehen – kaum jemals im Gleichgewicht und dauernd in Bewegung: Die eine Person wiegt schwerer, die andere leichter. Über- und Untergewicht dieser Art wollen wir in Anlehnung an Keith Johnstone aktuellen Status nennen.
Status, so verstanden, hat immer mit zwei oder mehreren Personen zu tun. Er bezieht sich auf das, was zwischen ihnen abläuft, und bewertet ihr aktuelles Verhalten, das heißt ihr Statusverhalten oder das Positionieren. Wenn wir sagen: Die Person A besitzt in der Situation X hohen Status, dann meinen wir A in Relation zu einer oder mehreren Personen B. B besitzt (oder besitzen) in der aktuellen Szene X einen niedrigeren Status als A. A dominiert B – sei es auch nur kurz oder unmerklich. Status bezieht sich auf das wechselseitige Verhalten von A und B und wie beide dies wahrnehmen und empfinden.
Dominanz und Unterordnung geschieht in vielen Fällen subtil, den Akteuren wird es nicht unbedingt bewusst. Beschreiben wir Status zuerst aus einem anderen Extrem: aus Erlebnissen, bei denen wir unter anderen Personen nachdrücklich oder anhaltend zu leiden hatten. Dabei fühlten wir uns vielleicht schüchtern oder verlegen. Ereignisse dieser Art können wir Unterwerfungserfahrungen nennen. Lucas Derks hat deren Merkmale so beschrieben:
1. Schüchternheit, Stammeln, Erröten, Herzklopfen, stockender Atem, Unfähigkeit, den Blickkontakt zu halten.
2. Der eigene Ausdruck, die Kreativität und Handlungsfähigkeit sind eingeschränkt. Man fühlt sich unfrei und blok_kiert.
3. Eine Neigung, der Autoritätsperson zu gehorchen – manchmal auch wider Willen.
4. Noch stärker: Man erfährt die Situation mehr von der Warte der Autoritätsperson als von der eigenen, man fühlt, denkt, sieht teilweise wie sie.
5. Eine Neigung, der Autoritätsperson nur positives Feedback zu geben: Komplimente, Zustimmung, Lob.
6. Furcht vor Zurückweisung oder Bestrafung durch die Autoritätsperson.
7. Eine Neigung, das eigene unterwürfige Verhalten auf Eigenschaften der Autoritätsperson zurückzuführen.
Das ist die eine, die bekanntere Seite der Medaille. Die Kehrseite sind Dominanzerfahrungen, in denen wir für andere eine Autoritätsperson dargestellt haben, sei es, dass wir bewundert und angehimmelt wurden oder dass uns gar unterwürfig begegnet wurde. Dominanzerfahrungen äußern sich so:
1. Ein (meist angenehmes) Gefühl von Macht, Stärke und Überlegenheit. Man denkt sich groß und besitzt ein gutes Selbstbild.
2. Die Erfahrung ausgedehnter Ausdrucksfähigkeit, ungehemmter Kreativität und Freiheit im Handeln.
3. Man erfährt ein überwiegend positives Feedback in Form von Lächeln, Geschenken, Höflichkeit, Unterwürfigkeit oder gar Servilität.
4. Wenn dies länger dauert: meist keine schlechten Nachrichten, niemand wagt es, der Autoritätsperson ein negatives Feedback zu geben.
5. Wenn sich dies verfestigt: Man erfährt die Situation nur noch von der eigenen Warte, die Gedanken und Gefühle der anderen spielen keine Rolle mehr.
6. Bei lang anhaltenden Beziehungen dieser Art: Man erfährt einen Mangel an Vertrautheit auf gleichberechtigter Basis, dies kann zu Desorientierung und Isolation führen.
7. Noch stärker: Misstrauen gegen andere und die Furcht, Macht zu verlieren.
8. Manchmal auch starke Zweifel, wer wirklich kontrolliert: Zwingen die Anhänger einen in die überlegene Position oder ist das ein Produkt eigener Leistungen, überlegener Eigenschaften und Aktivitäten?
9. Und: eine große Diskrepanz zwischen dem, was man zu sein glaubt (inklusive den eigenen Zweifeln) und dem, was die unterwürfigen anderen einem signalisieren.
Dominanz- und Unterwerfungserfahrungen sind Extreme auf einer weit gespannten Skala. Ihr mittlerer Bereich ist die Erfahrung von Gleichheit: Über oder unter jemandem zu sein, das spiele, so glaubt man, in dieser Situation keine Rolle. Nach Keith Johnstone ist dies nur in ganz wenigen Fällen möglich, etwa bei Freundschaft. Freunde und Freundinnen necken einander gerne. Die beiden Autoren (sie sind jahrelang befreundet) begrüßen sich: »Guten Morgen, Herr Professor, haben Sie gut geschlafen?« – Redensarten, die Keith Johnstone so kommentiert: Freundschaft bedeute, dass man sich heimlich verständigt hat, mit Status spielerisch umzugehen. Man parodiert gleichsam sein soziales Gewicht. A wertet sich gegenüber B auf oder ab und B macht das Gleiche mit A – und beide wissen, dass es nur ein Spiel ist, das keiner ernst nimmt, und genau in dieser Haltung entsteht Freundschaft.
In allen anderen Fällen hingegen ist die Waage im Ungleichgewicht: A und B weichen von einer gleichberechtigten Mittelposition ab. A geht vielleicht auf der Skala einen Schritt in Richtung Dominanz, was B automatisch einen Schritt in Richtung Unterwerfung bringt. A und B spielen ein Statusspiel.
Frau X: »Gestern hatte ich ein schlimmes Erlebnis. Ich war mit einem Kunden im Restaurant. Als ich auf die Rechnung wartete, habe ich mich auf einmal so komisch gefühlt. Als ob ich ohnmächtig würde.«
Frau Y: »Gestern? Da hätte ich auch gerne in einem guten Restaurant gegessen. In der Kantine war es wieder einmal ungenießbar!«
Frau Z: »Ich weiß, was du meinst. Mir geht es auch manchmal so merkwürdig. Vor einem Monat war es besonders extrem ...«
Die drei Frauen reden in höflichem Ton, ein scheinbar friedliches Gespräch. Aber gleichzeitig versuchen sie die ganze Zeit, ihr soziales Gewicht auf Kosten der anderen zu erhöhen. Frau X beginnt mit einem Hochstatus-Zug: Ein interessantes Ereignis wird berichtet. Y blockt ab und wischt das beiseite. Z macht ein noch aufschlussreicheres Statusmanöver: Sie geht auf Y nicht ein (wertet sie also ab), sondern antwortet auf X und verleiht ihr damit ein größeres Gewicht. Aber im nächsten Satz positioniert sie sich über die beiden: Jetzt schildert sie das viel bemerkenswertere Erlebnis, dem die Aufmerksamkeit aller zu gelten hat. Satz für Satz, Geste für Geste ändert sich die Waage im subtilen Statusspiel: Jede gibt vor, freundlich zu sein, und alle sägen am Stuhl der anderen.
Spiele dieser Art laufen die ganze Zeit, wir achten vielleicht nicht aufmerksam genug darauf. Tatsächlich kann jede Begegnung auch als Statusspiel verstanden werden, man muss nur genau hinsehen. In vielen Fällen ist das Statusmoment wichtiger als der Inhalt der Worte. Im Alltagsleben, in der Firma oder im Verein stellen Menschen unbewusst immer ein Statusverhältnis her. Jede und jeder bringt sich so lange in eine bestimmte Position, ob hoch oder niedrig, bis es »passt«. Wenn das nicht erreicht werden kann, fühlen wir uns unwohl: Irgendetwas stimmt nicht.
Statusgefühle und Empfindungen für Statuslagen sind uns wohlbekannt. Wir sind Statusexperten, ohne das vielleicht zu wissen. Wir besitzen feine Antennen, die auf Dominanz- und Unterordnungssignale ausgerichtet sind. Meist reagieren wir automatisch auf Statusmanöver: Wenn uns jemand kritisiert, große ausholende Gesten macht, uns auf die Schultern klopft, sich abrupt abwendet, uns scharf mustert, in besonders teuren Klamotten auf den Plan tritt oder langsam und pointiert redet (alles Handlungen, die meist hoch positionieren), dann werden wir mit Sprache und Körper Antwort erteilen. Wir werden dem Versuch, uns direkt oder unmerklich »von oben« behandeln zu wollen, auf unsere Weise entgegnen – und sei es auch nur mit einem Stirnrunzeln, einem Achselzucken, einer etwas schärferen Rede – oder mit bewundernden Blicken. Egal wie: Wir leisten so unseren Beitrag im laufenden Statusspiel, und von seinem Ablauf hängt es nicht nur ab, wie wir uns fühlen, sondern auch, welche Erfolge und Misserfolge wir erzielen. Um soziale Interaktionen zu verstehen, muss man Status verstehen.
Mit diesem Buch laden wir ein, den Blick auf die allgegenwärtigen Statusspiele zu lenken: wie wir Worte und Gesten, Raum und Zeit permanent, wenn auch unbewusst, einsetzen, um uns über andere zu stellen oder ihnen klein beizugeben. Wir sprechen von Hochstatus- und Niedrigstatusverhalten und meinen damit Verhaltensweisen, die jeder anwenden kann, egal ob er in der sozialen Hierarchie oben oder unten ist. Aber zuerst muss man sich dessen bewusst werden.
Sozialer Status und Hierarchie
Status wird normalerweise als gesellschaftliche Stellung verstanden, als Stand, auch als der Wert oder die Bedeutung einer Person in den Augen der Öffentlichkeit. Status dieser Art wollen wir sozialen Status nennen. Sozialer Status weist Menschen einen »sozialen Ort« zu und gibt diesem »Ort« zugleich einen sozialen Wert. Damit wird Personen ein Platz in einer sozialen Hierarchie zugewiesen. Oft ist dies durch traditionelle Rollenbilder geprägt wie »Frauen sind weniger tüchtig als Männer«. Organisationen zeichnen sich dagegen durch formale Hierarchien aus, die implizit einen Manager höher bewerten als einen Arbeiter und in denen ein Mitglied des Vorstands dem Aufsichtsrat untertan zu sein hat. Sozialer Status »haftet« an einer Person, er kommt ihr wie ein festes Merkmal zu: jemand ist Vorstand, jemand ist Manager. Die Verteilung der Rangplätze in einer Hierarchie entspricht einem Nullsummenspiel: Was einer gewinnt, verliert jemand anders. Es kann eben nur eine Person den ersten Platz in einer Hierarchie einnehmen.
Frederick Merton hat das im Zusammenhang mit Status in der Wissenschaft als das Phänomen des »einundvierzigsten Sitzes« gekennzeichnet: Wer in die Académie Française aufgenommen wurde, hatte den Platz eines »Unsterblichen« erlangt – aber es gab immer nur 40 Plätze. Waren diese voll, konnte man nicht mehr »unsterblich« werden, auch wenn man sich noch so große Verdienste erworben hatte. Beispiele für »Inhaber des einundvierzigsten Sitzes« sind Leute wie Descartes, Pascal oder Moliere.
Für die Verteilung von Macht gilt Ähnliches. Je mehr jemand Macht über den anderen ausüben kann, umso ohnmächtiger ist der andere. Auch im Statusspiel, das wir als Waage verstehen, geht es um die relative Dominanz über andere: Ein Hochstatus-Zug macht einen Spieler »größer«, auf Kosten des aktuellen Gesprächspartners oder auf Kosten anderer Gruppen in der Umwelt.
Blake Ashforth und Glen Kreiner beobachteten das Verhalten von Arbeitern in Berufen, welche üblicherweise als eher abstoßend, »schmutzig« und von niedrigem sozialen Status angesehen werden: Leichenwäscher, Totengräber, Tänzerinnen in Nachtlokalen und Ähnliches. Diese Leute schaffen es jedoch, sich in ihrer Referenzgruppe eine positive Identität zu geben und damit ihren Status wechselseitig zu heben, indem sie sich gegenseitig versichern, wie notwendig und wertvoll ihre Arbeit für die Gesellschaft ist oder wie viel höher ihre Moral im Vergleich zu der ihrer Kunden ist. Etwa eine Nachtclubtänzerin: »Sie kommen samstagsabends her, betrinken sich und wollen an uns herumtatschen. Dann gehen sie am Sonntag in die Kirche und verdammen das, was wir machen. Im Allgemeinen, glaube ich, sind wir ein ganzes Stück ehrlicher als die!« Damit beanspruchen sie für sich hohen Status, obwohl sie in jeder sozialen Hierarchie ganz unten sind.
Statusverhalten ist unabhängig von der sozialen Position. Eine Hochstatus-Person kann Niedrigstatus spielen und umgekehrt. Statusverhalten ist kurzfristig, auf die jeweilige Situation bezogen. Es beschreibt die Verteilung sozialer Gewichte im gemeinsamen Handeln aller Beteiligten. Statusverhalten zeigt sich im momentanen Tun. In der kurzen Szene mit den drei Frauen X, Y und Z konnten wir den flüchtigen Wechsel des aktuellen Status beobachten: Jeder Satz hat die soziale Waage zwischen den Anwesenden verschoben. Viele weitere Beispiele finden sich in den kommenden Kapiteln. Unabhängig davon besitzen X, Y und Z sozialen Status.
Nehmen wir an, sie arbeiten in derselben Firma und X ist eine Abteilungsleiterin, Y ihre Mitarbeiterin und Z ein Lehrling, der vor zwei Tagen eingestellt wurde. Mit dieser Information bekommt die Szene eine neue Bedeutung. Im Normalfall würde man erwarten, dass die Abteilungsleiterin (Frau X) von ihrer Mitarbeiterin (Frau Y) nicht unterbrochen wird und schon gar nicht, dass eine junge Anfängerin (Frau Z, ganz unten in der betrieblichen Hierarchie) ein Gespräch dominieren kann. Der aktuelle Status widerspricht dem dauerhaften sozialen Status. In der Regel ist aber der soziale Status ein starker Trumpf im Statusspiel: Die Abteilungsleiterin kommt mit einem anderen »Gewicht« daher als ein Neuling. Als Vorgesetzte hat sie es leichter, dominant vorzugehen, Autorität auszustrahlen und sich Respekt zu verschaffen. Dies gilt immer nur im gegenwärtigen Kontext – in der Disco mag das umgekehrt sein.
Aber sozialer Status ist keine Garantie für das aktuelle Statusgewicht. Wenn es der Abteilungsleiterin nicht gelingt, sich regelmäßig im Betrieb Gehör zu verschaffen, gilt sie als »schwach«. Ihre Autorität wird brüchig und über kurz oder lang läuft sie Gefahr, ihren sozialen Rang und möglicherweise sogar ihren Job zu verlieren. Sie muss sich im Alltag fortwährend behaupten, mit anderen Worten, viele Statusspiele zu ihren Gunsten entscheiden. Ihr Statusverhalten muss ihre Position stützen. Das verlangt nicht immer nach Hochstatus-Verhalten, aber sie kann sich auf Dauer nicht nur niedrig positionieren. Auch darf sie Statusverhalten nicht mit bloßem Machtausüben verwechseln. Sie könnte mit der »Peitsche« agieren, ihre Mitarbeiterinnen durch Belohnungen und Bestrafungen disziplinieren. Aber für Macht gilt Emersons berühmter Satz: »Macht zu haben bedeutet, Macht auszuüben. Und Macht auszuüben bedeutet, Macht zu verlieren.«
Die Macht der Abteilungsleiterin begründet sich aus ihrer Stellung in der betrieblichen Hierarchie, man spricht von Positionsmacht. Der große Soziologe Max Weber bezeichnet dies als rationale Herrschaft...