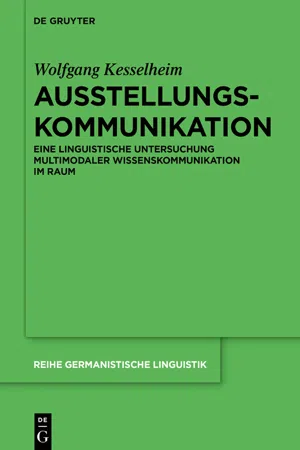1.1 Hinführung
Die vorliegende Arbeit widmet sich der text- und gesprächslinguistischen Erforschung der Kommunikation in Museen. Sie löst ein Forschungsdesiderat ein, indem sie systematisch die grundlegenden Merkmale und charakteristischen Ausdrucksmittel der Ausstellungskommunikation untersucht (vgl. Kaiser 2006: 14), und betritt theoretisch-methodisches Neuland, indem sie Methoden für die Analyse raumgebundener, multimodaler Wissenskommunikation entwickelt, einer Form von Wissenskommunikation also, in die mehrere Zeichenvorräte zugleich involviert sind.
Mit „Ausstellungskommunikation“ ist hier zweierlei gemeint: zum einen die Angesichtskommunikation zwischen Besuchern1, die sich gemeinsam eine Museumsausstellung anschauen und sich dabei über das aktuell Gesehene und Gelesene austauschen (im Folgenden: „Kommunikation in der Ausstellung“); zum anderen die ‚verdauerte‘ Kommunikation (vgl. Ehlich 1994: 35) zwischen Ausstellungsmachern und Besuchern, die über den Ausstellungsraum mit seinen Exponaten, erläuternden Texten usw. zustande kommt (die „Kommunikation durch die Ausstellung“).2
Beide Spielarten der Ausstellungskommunikation werden hier zunächst getrennt voneinander untersucht, bevor dann ein gemeinsamer Analyserahmen vorgestellt wird, der es erlaubt, beide Spielarten der Ausstellungskommunikation systematisch aufeinander zu beziehen.
Im ersten Untersuchungsteil (Kapitel 3) werden die charakteristischen Merkmale der Kommunikation durch die Ausstellung bestimmt. Aus textlinguistisch-semiotischer Perspektive werden die im Ausstellungsraum vorhandenen Bedeutungspotenziale identifiziert und systematisiert und darauf aufbauend die Kommunikation durch die Ausstellung als spezifischer Fall einer Wissenskommunikation beschrieben, die mit raumgebundenen Zeichen aus den unterschiedlichsten Zeichenvorräten operiert. Datengrundlage dieses Analyseteils ist ein Korpus von Fotos aus naturwissenschaftlichen Museen, das Texte und Exponate in ihrem konkreten räumlichen Vorkommen dokumentiert.
Im zweiten Untersuchungsteil (Kapitel 5) geht es um die Frage, wie Besucher das im Raum arrangierte Kommunikationsangebot für ihre soziale Praxis des gemeinsamen Museumsbesuchs nutzen. Mit den Mitteln der Konversationsanalyse wird rekonstruiert, wie in Museumsbesuchen Elemente der physischen Umwelt als raumgebundenes Kommunikationsangebot interpretiert werden und wie Besucher dieses Angebot für ihre Konstruktion von neuem Wissen zum ausgestellten Fachthema nutzen. Die Materialgrundlage des zweiten Teils bilden Videoaufnahmen von authentischen, selbst gesteuerten Museumsbesuchen von Paaren, Familien und anderen kleinen Besuchergruppen.
Integriert werden diese beiden Untersuchungsteile in Kapitel 6 mit Hilfe eines Konzepts, das im Rahmen einer konversationsanalytisch inspirierten Textlinguistik entstanden ist: das Konzept der „Textualitätshinweise“, wie es in Hausendorf/Kesselheim (2008) vorgestellt und seitdem weiterentwickelt worden ist (Hausendorf/Kesselheim 2016, Hausendorf et al. 2017). Aus der Sicht dieses Konzepts lässt sich die kommunikative Nutzung des Ausstellungsraums im Rahmen des gemeinsamen Museumsbesuchs als Auswertung von im Ausstellungsraum angelegten „Hinweisen“ auffassen, die den Besuchern eine bestimmte Nutzung des Raums und seines kommunikativen Angebots nahelegen. Um diesen Integrationsvorschlag empirisch zu fundieren, werden erneut Interaktionsereignisse aus dem Videokorpus untersucht.
Theoretisch-methodisch ist die Untersuchung in einer neueren, an der Materialität, Medialität und „Lokalität“ (Fix 2008) der Lektüre interessierten Textlinguistik sowie in einer multimodal erweiterten Konversationsanalyse (s. z.B. Mondada 2019) verankert. Hieraus ergeben sich einige generelle Konsequenzen für das Verständnis des Gegenstands und das Vorgehen bei der Analyse.
- –
Die Erscheinungsformen der Ausstellung im Ausstellungsraum werden weder als ‚Verräumlichung‘ von Wissensstrukturen aufgefasst noch als ‚Fenster‘ zu den Motiven, Intentionen oder Strategien von Besuchern oder Ausstellungsverantwortlichen. Vielmehr werden sie als kommunikatives Phänomen sui generis ernst genommen, das es möglichst ‚oberflächennah‘ zu untersuchen gilt (s. Bergmann 2001).
- –
Zur Oberfläche der Ausstellungskommunikation kann prinzipiell alles gehören, was im Moment der Rezeption wahrnehmbar, lesbar oder über Vorwissen („Vertrautheit“, Hausendorf et al. 2017: 96–105) aktivierbar ist. Das macht es notwendig, bei der Analyse von Daten auszugehen, die das Zeichenarrangement im Raum möglichst in seinem genauen Vorkommenszusammenhang dokumentieren.
- –
Entsprechend der analytischen Grundhaltung der Konversationsanalyse basiert die Untersuchung der Ausstellungskommunikation nicht auf kontrollierten Experimenten oder Befragungen von Besuchern oder Ausstellungsverantwortlichen, sondern auf Fällen authentischer Kommunikation (s. Kallmeyer 2006): also Videoaufnahmen authentischer Ausstellungsbesuche und Fotografien, die den Ausstellungsraum möglichst detailgetreu dokumentieren.
- –
Schließlich geht die Analyse der Ausstellungskommunikation davon aus, dass die Bedeutung(en) der Ausstellung nicht einfach gegeben sind. Sie versucht zu rekonstruieren, wie Besucher die Bedeutung(en) der Ausstellung im Verlauf ihres gemeinsamen Museumsbesuchs aktiv herstellen und beschreibt, was der Ausstellungsraum für diese Konstruktionsleistung an Potenzialen zur Verfügung stellt. Dabei nimmt sie die Ausstellungskommunikation ganz dezidiert von dem Moment der Rezeption aus in den Blick – sei es ‚virtuell‘, also als Fluchtpunkt der Analyse (in Kapitel 3), sei es in der Beobachtung tatsächlicher Rezeptionsvorgänge (in den Kapiteln 5 und 6).
Über die systematische Beschreibung der Ausstellungskommunikation hinaus verfolgt die Arbeit drei miteinander verbundene Ziele:
-
zur Weiterentwicklung der Theorie multimodaler Kommunikation beizutragen;
-
neue Einsichten in die Rolle des Raums für die Kommunikation zu erbringen und eine Antwort auf die Frage zu geben, wie die Raumgebundenheit von Kommunikation beschrieben werden kann; und
-
die Erforschung der Wissenskommunikation um raumbasierte Kommunikationsformen zu erweitern.
Indem sie diese Ziele verfolgt, leistet die Arbeit einen Beitrag zu einer Reihe aktueller Diskussionszusammenhänge in der Linguistik.
Die Arbeit trägt zur aktuellen Multimodalitätsforschung bei (s. etwa Tan/ O'Halloran/Wignell 2020, Bateman/Wildfeuer/Hiippala 2019, Jewitt 2017, Norris 2016), indem sie ein multimodales Ensemble analysiert, in dem die einzelnen Modalitäten nicht in klar separierten ‚Blöcken‘ vorliegen, sondern sich gegenseitig durchdringen, und sie trägt zur Theorieentwicklung der Konversationsanalyse bei, indem sie einen Weg aufzeigt, wie die Untersuchung nicht körpergebundener Zeichenressourcen in die konversationsanalytische Interaktionsforschung einbezogen werden kann – ein Thema, das ausgehend von den Pionierarbeiten Charles Goodwins oder Christian Heaths (s.u., 4.1) immer stärker in den Mittelpunkt der Konversationsanalyse rückt.
Gleichzeitig knüpft die Arbeit an aktuelle Debatten um die Rolle des Raums für Kommunikation und Interaktion an (vgl. den Universitären Forschungsschwerpunkt „Sprache und Raum“ an der Universität Zürich oder die multidisziplinäre Forschung im Berliner SFB 1265 „Re-Figuration von Räumen“). Die Untersuchung der Ausstellungskommunikation als spezifischem „Fall“ ermöglicht es, allgemeine Charakteristika dieses trotz einiger Forschungsanstrengungen noch untererforschten Aspekts von Kommunikation systematisch zu beschreiben. So trägt die Arbeit zur Debatte um die Rolle des Raums für Kommunikation und Interaktion bei, die sowohl in der Textlinguistik als auch in der Konversationsanalyse von hoher Relevanz ist (s.u. 2.2.2).
Schließlich erweitert die Untersuchung der Ausstellungskommunikation das Spektrum der schon seit einigen Jahren stetig im Aufschwung begriffenen Forschung zur lokalen Herstellung von Wissen in der Interaktion. Durch die Entwicklung eines gemeinsamen Analyserahmens, in den die Untersuchung der Kommunikation in der Ausstellung und die der Kommunikation durch die Ausstellung integriert werden, trägt die Arbeit zu Bemühungen bei, die Erforschung der Wissenskommunikation in face-to-face-Situationen und in medial vermittelter Kommunikation miteinander zu verbinden, die bisher im Rahmen der Fachsprachenforschung und der Erforschung der Experten-Laien-Kommunikation nur wenig Berührungspunkte aufwiesen (s. 2.2.3).