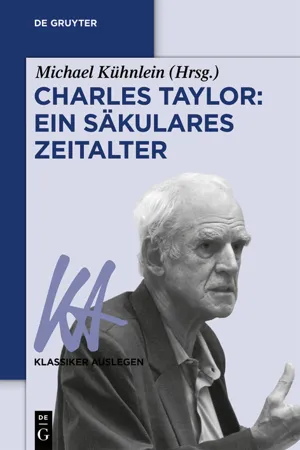1Einführung: Taylors Gegenwart
Charles Taylor zählt zu den einflussreichsten Philosophen der Gegenwart. Sein Werk ist in den letzten Jahren vielfach prämiert und international ausgezeichnet worden – bis hin zur Verleihung des „inoffiziellen“ Nobelpreises für Philosophie, den Kluge-Preis, den er 2015 gemeinsam mit Jürgen Habermas entgegennehmen durfte. Damit wurden aber zugleich zwei Denker philosophisch ausgezeichnet, die in ihren Arbeiten pikanterweise von den tragenden Selbst-Vorstellungen der Moderne abgewichen sind: Denn sowohl Habermas als auch Taylor eint die Überzeugung, dass die freiheitlichen Errungenschaften der Moderne auf Dauer nur mit der Religion und nicht gegen sie zu retten sind. Während Habermas hierfür ein ‚postsäkulares‘ Lernmodell zwischen Vernunft und Religion vorschlägt, setzt Taylor bei den vorbegrifflichen Sinnbedingungen unseres Daseins an, um bereits auf der Ebene der Selbst-Interpretation den Code des säkularatheistischen Vernunftdenkens zu entschlüsseln. Nicht säkulare Übersetzbarkeit (Habermas), sondern die kosmopolitische Anerkennung von spiritueller Vielfalt ist Taylors Weg aus den Malaisen der Moderne. Die Aura des Säkularen – bei Taylor verweht.
Dieses ausgleichende, auf die Überwindung von Gegensätzen abzielende philosophische Naturell ist mit Taylors eigener Biographie auf das Engste verknüpft: 1931 in Montreal geboren, wächst er in einer traditionell konfliktreichen, mithin ambivalenten Kultur auf, die durch die (politische) Zweisprachigkeit einer eigenständig-frankophonen und einer föderal-angelsächsischen Lebenswelt geprägt ist. Schon früh ist er also mit den Erfahrungen sozial-politischer Heterogenität vertraut – und mit den daraus resultierenden Problemen von Anerkennung und Missachtung, von Autonomie und Differenz, von Integration und Ausgrenzung. Taylors Motivation, diese dissoziativen Fliehkräfte der modernen Gesellschaft einzudämmen, wird deshalb bereits in jungen Jahren zu einer verlässlichen Quelle seines politischen Handelns; zwar scheitert er mit seinem sozialdemokratischen Engagement für die NDP (New Democratic Party) gleich mehrfach bei Mandatswahlen für einen Sitz im House of Commons, doch seine Kritik an einer liberal-individualistischen Politik bleibt in Kanada über diese parlamentarischen Misserfolge hinaus weiterhin einflussreich (vgl. dazu Honneth 1988; Rosa 1998; Breuer 2000).
Die politischen Ambitionen Taylors sind zu dieser Zeit freilich noch ohne genaue sozialphilosophische Rückkopplung; und eine besondere Affinität zu religionsphilosophischen Fragestellungen lässt sich schon gar nicht ausmachen: Zunächst studierte Taylor nämlich an der McGill Universität in Montreal Geschichte; danach wechselte er nach Oxford, um sich der Philosophie zu widmen. Diese Entscheidung brachte ihn in Kontakt mit seinem lebenslangen Lehrer und Freund Isaiah Berlin. Nach seiner Promotion 1961 (The Explanation of Behaviour, veröffentlicht 1964), die eine entschiedene Kritik am Naturalismus formulierte, kehrte er wieder nach Kanada zurück; zunächst als Assistenzprofessor, ab 1962 dann als ordentlicher Professor für Philosophie und Politikwissenschaften an der Universität in Montreal.
1.1Hegel
In dieser Zeit, bis zu seinem erneuten Lehrstuhlwechsel nach Oxford 1976, arbeitete Taylor an seiner großen Hegel-Monographie (1975; dt. 1978), die dadurch aufhorchen ließ, dass sie Hegel als einen philosophischen Zeitgenossen porträtierte, mit dessen Hilfe die Freiheitsirrtümer der Moderne erstmals umfassend auf den Begriff gebracht werden konnten: „Hegel war […] einer der gründlichsten Kritiker desjenigen Begriffs der Freiheit, der diese als Abhängigkeit nur vom Selbst definierte. Mit bemerkenswertem Einblick und großer Voraussicht zeigte er dessen Leere und potentiell zerstörerische Wirkung.“ (1978, 747) In dieser frühen Theoriephase war es also vor allem Hegel, der das Interesse Taylors an einer tieferen Durchdringung des modernen Unbehagens geweckt hat. Er war fasziniert von dessen Versuch, jene Synthese philosophisch zu verwirklichen, „nach welcher die romantische Generation suchte und nach welcher sich das gesamte Zeitalter sehnte, nämlich: die sich selbst ihr Gesetz gebende rationale Freiheit des Kantischen Subjekts mit der im Menschen vorhandenen Einheit des Ausdrucks und mit der Natur zusammenzubringen“ (ebd., 707). Diese spirituelle Verstehensquelle der modernen Identität hat Taylor immer wieder angezapft – auch wenn Hegels Name in den späteren Publikationen nicht mehr regelmäßig fällt. Seine Zurückhaltung in der causa Hegel lässt sich wohl am ehesten damit begründen, dass Taylor schon damals die identitäre Logik des Absoluten nicht geteilt hat, von der Hegel meinte, sie seiner Metaphysik unbedingt überstülpen zu müssen (vgl. ebd., 706f.).
In den darauffolgenden Jahren, die mit philosophischen Lehrtätigkeiten an den Universitäten in Oxford (1976–1981) und Montreal verbunden waren (ab 1979), bemühte sich Taylor deshalb verstärkt darum, das spekulative Grundsatzprogramm Hegels in eine Anthropologie starker Wertungen umzuarbeiten; so sollten Hegels Einsichten in die expressive Verstehensnatur unseres Handelns gewahrt bleiben, ohne ihren Ausdruck an die geschichtlichen Identitätsmanifestationen eines absoluten Geistes zu binden. Doch die weiteren Artikulationsversuche des Guten mussten Taylor von den eingeschlagenen Pfaden Hegels wegführen. Denn ihm wurde schnell klar, dass es nicht mehr darum ging, identitätslogische Sackgassen zu vermeiden; vielmehr musste er insgesamt das philosophische Genre wechseln und eine andere Erzählweise entwickeln, um dem ursprünglichen ausdruckstheoretischen Protest Hegels einen modernen Ausdruck verleihen zu können. Denn während Hegel von versöhnten Geist-Verhältnissen ausging, die der Philosoph in einer Endgeschichte des Begriffs nachzuerzählen hatte, betrachtet Taylor post-hegelisch die Erzählung selbst als dramatisches Narrativ, in dem sich das Subjekt mit den Transformationen seines Selbstverständnisses auf das Tiefste verbindet. Was also Hegel vormals an Expressivität auf das kosmische Geistgeschehen übertragen hatte, nimmt Taylor im Laufe der Zeit wieder zurück und konzentriert sich auf die vom Vernunftsystem unterdrückten kreativen Ausdruckspotenziale des Menschen.
1.2Die vergessenen Quellen des Selbst
In dieser Zeit des Nachdenkens fällt die Entstehung der großen Publikation über die Quellen des Selbst (1989; dt.: 1994). Sie liest sich in weiten Teilen wie eine weiterführende Kritik Hegels an den Freiheitsverstellungen des politischen Liberalismus – dieses Mal aber mit der hermeneutischen Pointe, dass ihre Artikulationen nicht hinter dem absoluten Geist, sondern hinter dem historisch bereits erreichten Ausdrucksniveau des Guten zurückbleiben. Taylor versucht daher, das Unbehagen an der Moderne (so ein weiterer Buchtitel von 1995) von der Genealogie der neuzeitlichen Identität her zu beantworten. Mit der peniblen Rekonstruktion ihrer Entstehungsgeschichte will er an jene konstitutiven Güter erinnern, die (wie Platons Idee des Guten, der christliche Theismus oder der romantische Naturbegriff) einmal für den Selbstausdruck der Moderne bestimmend waren – und es nun nicht mehr sind, weil das Desengagement der Vernunft die instrumentelle Kontrolle über unsere Gefühle und Handlungen übernommen hat. Insofern droht die Moderne, an sich selbst zu ersticken, weil sie ihre Verbindung zu den eigenen Ausdruckswurzeln interpretatorisch kappt.
Für Taylor kulminiert daher die Selbstbejahungskrise der Moderne in der menschlichen Unfähigkeit zur Bejahung des Guten. Dieses Unvermögen verhindert einen dauerhaften authentischen Freiheitsausdruck in den Selbsteinstellungen der modernen Subjektivität. Denn ohne Bejahung reduziert sich die Welt auf das, was sie ist, wobei in einer solchen naturalistischen Erkenntnishaltung ein sinnvolles Sprechen über die Dialektik der Aufklärung nach Taylor auch nicht mehr möglich wäre. Hier vermutet er also in den Versuchen der liberalistischen Gegenseite, die Pathologien der Moderne rein mit den autonomen Mitteln der Vernunftkritik durchdenken zu wollen, einen expressivistischen Selbstwiderspruch: „Auch unter der Voraussetzung, daß wir die Würde der desengagierten Vernunft oder die Güte der Natur vollständig anerkennen, fragt es sich, ob das tatsächlich ausreicht zur Rechtfertigung der Wichtigkeit, die wir ihr beimessen, des moralischen Werts, den wir ihr zuschreiben, oder der Ideale, die wir darauf errichten.“ (1994: 561; vgl. dazu Kühnlein 2008; ergänzend: Abbey 2000, 195 ff.).
Taylors Ausdrucksanthropologie will also Wirklichkeit nicht nur einfach beschreiben, sondern selbst hervorbringen. Und zu dieser inhaltlichen Vermittlungsform des Guten gehört eben nicht nur Kunst und Philosophie, sondern auch Religion, um in der klassischen Trias von Hegel zu bleiben. Mit diesen Überlegungen weist Taylor der Religion nun endgültig eine tragende Rolle in der Bewältigung der Malaisen der Moderne zu. Denn ihre semantischen Ressourcen zur Wiederherstellung unserer Disposition zur Bejahung des Guten hält er im Grunde für unverwüstlich; sie sind aus Taylors Sicht „unvergleichlich viel größer“ (1994, 894) als reine Vernunftlösungen: Die „zentrale Verheißung einer göttlichen Bejahung des Menschlichen“ gilt ihm als umfassender, als „sie von Menschen ohne Hilfe“ (ebd., 898) jemals hätte ersonnen werden können.
Mit diesem persönlichen Glaubensbekenntnis endet Taylors Buch zu den Quellen des Selbst. Die damit verbundene normative Aufwertung des Theismus konnte er zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht validieren, denn dafür hätte er nicht eine Geschichte über die neuzeitliche Identität, sondern vielmehr eine Geschichte über den Mythos und die Wirklichkeit der Säkularisierungstheorie selbst schreiben müssen. Doch dafür hatte Taylor Ender der 1980er Jahre noch nicht die begrifflichen Mittel; allerdings war die zukünftige Argumentationsstrategie aufgrund der ideengeschichtlichen Vorleistungen Taylors bereits vorgegeben: Denn wenn es keinen philosophischen Grund mehr geben konnte, Gott oder die Religion aus den modernen Selbstverständigungsprozessen herauszulassen, konnte mit den linearen Entzauberungsteleologien (im Sinne von Max Weber) irgendetwas nicht stimmen; der Sinn des Säkularen musste demnach in etwas anderem bestehen als in der bloßen Auslöschung des Sakralen. Die Antwort darauf lieferte Taylor in seinem Opus magnum 18 Jahre später.
1.3Über die nicht erzählte Hintergrundgeschichte des säkularen Zeitalters
Charles Taylors monumentale Studie über Ein säkulares Zeitalter zählt gegenwärtig zu jenen raren Büchern, die die philosophischen, politischen und religiösen Herausforderungen der Zeit angenommen und begriffen haben. Hier hat der luzide Hegel-Kenner Taylor von Hegel offensichtlich viel gelernt – ohne sich von ihm allerdings intellektuell abhängig zu machen. Denn anders als Hegel geht es ihm nicht um das objektivistische Begreifen einer Universalgeschichte aus der Sicht des Absoluten oder um dessen religionssoziologische Übersetzung in säkular-teleologische Stellvertretungstheorien wie bei Max Weber, sondern er schlüpft meisterhaft in die Rolle des homo narrans, der die verborgene, aber komplementäre Hintergrundgeschichte zur Geschichte des Westens zu erzählen versucht.
Taylors Erzählmotive nehmen dabei ihren Anfang im sozial-expressivistischen ‚Unterbau‘ des säkularen Wandels: Sie sollen jene normativen Veränderungen in den vorgängigen kulturellen Sinn- und Verstehensbedingungen des Guten zum Ausdruck bringen, die sich auf die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen Imaginationsformen immanent ausgewirkt haben. (Den Begriff des ‚Unterbaus‘, den meines Wissens nach Taylor so nicht verwendet, setze ich hier bewusst ein, um Taylors methodisches Vorgehen der Artikulation von ökonomisch-materialistischen Interpretationen des gesellschaftlichen Überbaus in der Nachfolge von Marx und Engels zu unterscheiden.) Für Taylor ist Geschichte deshalb immer schon artikulierte Geschichte und in den Kreislauf der ewigen Wiedererzählung eingeschlossen – sie kann also nie auserzählt oder von einem hermeneutisch privilegierten Nullpunkt der Erfahrung, dem meta-ethischen „Blick von nirgendwo“ (Nagel 1992), fortschrittsideologisch eingefroren werden: Nicht Entzauberung, sondern die „Entzauberung der Entzauberungstheorie“ (Kühnlein 2014, 127) ist Taylors narratives Mantra der Moderne.
Diese expressivistische Wende in den neutralen Selbstdarstellungsmedien der aufgeklärten Vernunft, die man analog zur kopernikanischen Wende Kants in der Erkenntnistheorie auch als eine hermeneutische Kopernikanisierung der sozialwissenschaftlichen Denkungsart bezeichnen könnte, verändert die Erzähl-Statik der Moderne von Grund auf. Denn Taylor geht es hier nicht mehr um das apriorische Festschreiben einer säkularen Identität, die sich quasi in dem Moment unwiderruflich zu formieren beginnt, wo die Religion ihren eigenen Täuschungen erliegt. An dieser meta-ethischen Darstellung einer archimedischen Punktlandung der zeitlos-liberalen Identität in der westlichen Ideengeschichte hegt Taylor grundständige Zweifel, da sie ihre eigenen Wertüberzeugungen naturalistisch verschleiern und wesentlich „subtraktionslogisch“ argumentieren müsse: „Dieser Subtraktionsgeschichte zufolge ist die Moderne das Ergebnis des Wegwischens des alten Horizonts, und der moderne Humanismus könne nur durch das Schwinden älterer Formen zustande gekommen sein. Nur als Resultat des Todes Gottes sei er denkbar. Daraus folgt, daß man die humanistischen Anliegen eigentlich nicht rückhaltlos vertreten kann, wenn man die alten Überzeugungen nicht abgeschüttelt hat. Man kann nicht wirklich in der Moderne angekommen sein und dennoch an Gott glauben. Oder wenn man trotzdem glaubt, hat man Vorbehalte und steht zumindest teilweise – und vielleicht insgeheim – auf der gegnerischen Seite.“ (955)
Demgegenüber favorisiert Taylor einen Erzählstil, der den säkularen Wertewandel zunächst einmal von den kulturhistorischen Rahmenbedingungen des Guten her verständlich zu machen versucht. Dabei interessiert ihn besonders die Frage, inwieweit die veränderten Einstellungen in den säkularen Auffassungen der menschlichen Natur auf einen veränderten Ausdruck in unseren moralischen Selbstwahrnehmungen zurückzuführen sind. Das Sein bestimmt also nicht mehr das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein in die Welt gestellter Subjekte „umgreift“ (zu diesem wichtigen Begriff vgl. Jaspers 41987, 38ff.) das Sein – zumindest in der Weise, als dass ersichtlich wird, dass es keine unabhängige wissenschaftliche Entdeckung gibt, die nicht durch vorgängige Wertentscheidungen des Guten motiviert worden wäre. So ist der Aufstieg der modernen Naturwissenschaften nach Taylor nur denkbar, weil er im Glauben an die Souveränität Gottes fest verankert ist. Die Mechanisierung des Weltbildes verteidigt die göttliche Wahlfreiheit und entschärft die existenzielle Theodizeefrage (Leibniz). Insofern führt die Entdeckung der Natur „keinen Schritt, nicht einmal einen Teilschritt“, aus der „religiösen Auffassung“ heraus (169); auch der säkulare Humanismus der Moderne ist für Taylor kein rein epistemisches Projekt, da er in seinem universellen Wohltätigkeitsstreben eine tiefe Loyalität zum christlichen Erbe erkennen lässt (vgl. 956). Und das Gleiche gilt schließlich auch für den Atheismus der Gegenwart: Dessen moralische Anziehungskraft führt Taylor nicht auf den natürlichen Tod Gottes zurück (Nietzsche), sondern auf das Ideencharisma eines radikalen Existierens, wie es in dem Gedanken der unvordenklichen Selbstwahl zum Ausdruck kommt (Sartre, Camus). In den transzendenten Ablehnungsmotiven lässt sich somit eine vorgängige „ethische Einstellung“ identifizieren, die nach Taylor „zur Abgeschlossenheit drängt“ (913).
In dieser Perspektive ist der Erfolg des säkularen Denkens vor allem einem neuen Erleben der conditio humana geschuldet, die durch die individualistischen Wertvorstellungen eines autonomen Selbstverständnisses performt wird. Hier wird allerdings nichts mehr ‚entdeckt‘, was nicht schon vorher im Zirkel menschlichen Selbstverständnisses ontologisch angelegt ist. Jede Theorie bleibt daher von der Art ihrer Erzählung abhängig. Hier gibt es nichts mehr, was sich ‚autonom‘ oder ‚neutral‘ konstruieren ließe. Und in diesem Sinne bringt nach Taylor der säkulare Wandel im menschlichen Erfahrungsbegriff kein meta-ethisches Faktum über die objektive Natur des Menschen zur allgemeinen Kenntnis, sondern er etabliert vielmehr eine weitere Ausdruckskonkurrenz in den tradierten Beziehungen auf das Gute, die motivational in einer alternativen Auffassung von Ethik verankert ist – einer Ethik, die jetzt von den humanistischen Idealen der souveränen Selbstbehauptung angetrieben wird. Das anhaltende Mysterium des säkularen Erfolges ist für Taylor also letztlich in den vorgängigen ethischen Einstellungen zu suchen: „In Wirklichkeit ist die Erfahrung durch eine leistungsfähige Theorie zurechtgestutzt worden, die den Primat des Individuellen, des Neutralen und des Innerpsychischen als Ort der Gewissheit fordert. Welcher Motor treibt diese Theorie? Nun, bestimmte ‚Werte‘, Tugenden, Vorzüge – nämlich die des unabhängigen, desengagierten Subjekts, das reflektiert und selbstverantwortlich […] seine eigenen Denkprozesse steuert. Darin liegt eine bestimmte Ethik der Unabhängigkeit, der Selbstbeherrschung, der Selbstverantwortung und des Kontrolle ermöglichenden Desengagements. Diese Haltung setzt Mut voraus sowie die Weigerung, sich mit den billigen Bequemlichkeiten der Autoritätshörigkeit, den Tröstungen der verzauberten Welt oder der Kapitulation vor den Regungen der Sinne abzufinden. Dieses ganze von ‚Werten‘ durchsetzte Bild, das ein Ergebnis der sorgfältigen, objektiven und voraussetzungslosen Forschung sein soll, wird jetzt so präsentiert, als sei es von Anfang an da gewesen und habe den ganzen Prozeß der ‚Entdeckung‘ vorangetrieben.“ (933 f.)
Mit diesem Einblick in die expressivistischen Voraussetzungen des epistemischen Vernunftstrebens richtet sich Taylors Erzählziel neu aus. Oder um es griffiger zu formulieren: Taylor strebt eine umfassende ‚Motivationsgeschichte‘ der Moderne an, in der die wissenschaftliche Entdeckung des Säkularen vor dem Hintergrund der Neubildungen der moralischen Identität rekonstruiert wird. Nicht die institutionelle Verdrängungskraft, sondern die veränderte Wahrnehmung auf unsere Identität, auf „unseren Ort in der Welt und den impliziten Werten“ (943), steht im Mittelpunkt einer solchen Erzählung. Taylors Geschichte ist also eine Geschichte über die beweglicher gewordenen ontologischen Rahmenbedingungen des Guten, die aus dem Gottesglauben eine Option gemacht haben. Während subtraktionslogische Vorstellungen hier nur einseitige Begründu...