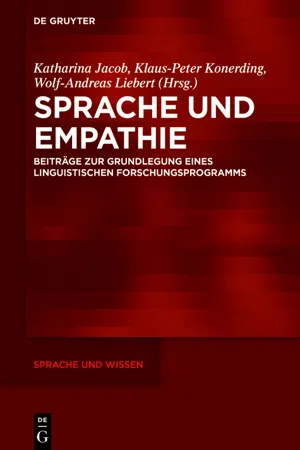Parameter und Reichweite der Empathie
Thiemo Breyer, Philosophisches Seminar, Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln, Tel.: 0221/470-1235, Fax: -1964, thiemo.breyer[at]uni-koeln.de
Theoretische Grundlagen und ethische Diskussionen
Zusammenfassung: Dieser Beitrag bietet einen Einblick in den Facettenreichtum derjenigen Phänomene, die in der philosophischen und interdisziplinären Forschung unter dem Begriff der Empathie untersucht werden. Hierzu wird eine Gliederung mehrerer Grundformen eingeführt, von der ausgehend die Grenzen der menschlichen Empathiefähigkeit, die sie beeinflussenden Parameter und ihre Reichweite innerhalb der verschiedenen Dimensionen subjektiver und intersubjektiver Erfahrung skizziert werden, um sodann nach den ethischen und moralischen Konsequenzen der Wechselwirkungen zwischen diesen Dimensionen zu fragen. Im Zuge dessen kommen einige klassische Autoren der Philosophiegeschichte zu Wort, die widerstreitende Einschätzungen bezüglich des Wertes affektiv-emotionaler Empathie geben. Mit Rekurs auf das Mitleid als einem traditionell häufig in Ethik und Moralphilosophie thematisierten Phänomen, kann der Stellenwert dieses Empathiemodus beleuchtet werden. Es zeigt sich dabei, dass die Skepsis mancher Philosophen gegenüber dem Mitleid in aktuellen Diskussionen über die ‚dunklen Seiten‘ der Empathie wiederkehrt. So wird beispielsweise erörtert, ob Empathie auf einen intrinsischen Altruismus des Menschen als animal sociale hinweist oder ob Empathie ein egoistisches Mittel ist, um die eigenen Zwecke gegenüber anderen durchsetzen zu können. Im Ausblick wird eine moderat optimistische Antwort auf diese Frage gegeben.
Schlüsselwörter: Affektivität, Empathieblockade, Ethik, Kognition, Mitleid, Leibkörper
1Einleitung
Als Einstieg kann eine lebensweltliche Vignette helfen, die Komplexität empathischer Erlebnisse sichtbar zu machen: Stellen Sie sich vor, Sie gehen nach einem aufreibenden Arbeitstag, an dem Sie einen Streit mit ihrem Vorgesetzten hatten und entsprechend schlecht gelaunt sind, zur Geburtstagsparty eines guten Freundes. Sie betreten den festlich geschmückten Raum und bemerken sofort die Heiterkeit, die hier herrscht, wodurch sich Ihre eigene Stimmung bereits ein wenig aufhellt. Alsbald wird „Happy Birthday“ angestimmt, was dem Jubilar sichtlich gefällt: Er strahlt über das ganze Gesicht. Wie Sie Ihren Freund an seinem Wiegenfest in guter Gesellschaft so sehen, freuen Sie sich mit ihm und für ihn. Während weiter gesungen wird, schweift Ihr Blick im Raum umher und Sie bemerken, dass einer der Gäste nicht singt. Sie fragen sich, warum dies wohl der Fall ist und erwägen eine Reihe von Gründen: Er könnte Halsweh haben; er könnte frustriert sein, weil er glaubt, er sei ein schlechter Sänger; es wäre aber auch möglich, dass er das Geburtstagslied schlichtweg langweilig findet; oder er will mit seinem Schweigen sogar gegen die ständige Wiedergabe derartigen Liedguts rebellieren. Während Sie gedanklich diese Optionen abwägen, wandert Ihre Aufmerksamkeit weiter und Sie bemerken einen Gast, der offenbar beim Willkommenssekt reichlich zugegriffen hat, angetrunken ist und in schrägen Tönen lauthals mitgrölt. Eine Freundin, die direkt neben Ihnen steht, ist recht amüsiert und kichert angesichts dieser Einlage. Sie bemerken, wie unwillkürlich auch in Ihnen ein Kichern aufsteigt, Sie von Ihrer Nachbarin geradezu damit angesteckt werden. Doch es mischt sich auch ein widerstrebendes Gefühl in das Sie schüttelnde Kichern hinein: Sie schämen sich für den Betrunkenen über sein albernes Verhalten und reflektieren darauf, ob das Ganze überhaupt ein geeigneter Anlass ist, um sich zu belustigen. Plötzlich stimmt der zuvor stumme Gast mit in das Geburtstagslied ein, was bei Ihnen die Einsicht hervorruft, dass er nun wahrscheinlich keine Angst mehr hat, sich zu blamieren. Es bewahrheitet sich Ihrer Einschätzung nach also einer der erwogenen Gründe für das Schweigen, nämlich, dass der Gast von sich selbst denkt, er sei ein schlechter Sänger, es ihm jetzt aber einerlei ist, ein wenig daneben zu liegen, da der Betrunkene sich bereits blamiert hat. Der Frau des Jubilars ist die Situation sichtlich peinlich, was Sie bemerken und woraufhin Sie Mitleid mit ihr empfinden. Sie fragen sich, wie es ihr in diesem Moment wohl ergeht, stellen sich dies bildhaft vor und beschließen, nach dem Lied zu ihr hinüber zu gehen und sich zu erkundigen, sie abzulenken oder gegebenenfalls zu trösten.
Noch bevor der letzte Ton erklungen ist, haben Sie eine ganze Reihe leiblicher, gefühlsmäßiger, gedanklicher und handlungsleitender Erlebnisse gemacht, die die Situation der Geburtstagsparty gliedern. Erstens erlebten Sie eine affektive Resonanz, bei der sich die Stimmung, die sich über den Tag hinweg in Ihnen aufgebaut hatte, mit der Atmosphäre, die im Raum herrschte, verband. Zweitens spielte sich eine Episode unmittelbaren Ausdrucksverstehens ab: Die Freude, die dem Geburtstagskind im Gesicht stand, wurde von Ihnen direkt wahrgenommen, was in einer Mitfreude resultierte. Drittens spürten Sie die leibliche Synchronisierung im gemeinsamen Singen, die durch das Aufmerken auf ein offenkundiges Stummbleiben einer Person und eine hörbare Dissonanz, versursacht durch eine andere Person, gestört wurde. Viertens setzte ein Nachdenken über die Gründe des schweigenden Gastes ein, also eine Mentalisierung, wobei sich einer der hier erwogenen Gründe später durch eine Kontextinformation plausibilisieren sollte. Fünftens vollzog sich eine Gefühlsansteckung mit entsprechender körperlicher Reaktion im unwillkürlichen Mitkichern mit Ihrer Nachbarin. Sechstens empfanden Sie eine stellvertretende Emotion, nämlich die Fremdscham über den Trunkenbold und sein unziemliches Gebaren. Siebtens versetzten Sie sich imaginär in die Gastgeberin hinein, um sich vorzustellen, wie es ihr wohl ergeht – eine phantasiemäßige Simulation, die bei Ihnen Mitleid auslöste und Sie motivierte zu helfen.
2Diversität von Empathiekonzepten und Systematisierung von Empathiedimensionen
Vergegenwärtigt man sich die interdisziplinäre Literatur der vergangenen Jahrzehnte zum Thema Empathie, so findet man zahlreiche Konzeptualisierungen und Definitionsvorschläge, die mal das eine, mal das andere Erlebnis aus der Liste der eben genannten herausgreifen und besonders betonen. Dabei sehen sich die Autorinnen und Autoren häufig unter dem Druck, eine möglichst präzise und enge Definition anzubieten, wodurch benachbarte Prozesse aus dem Blick geraten. Forschungspolitisch mag es attraktiv erscheinen, auf diese Weise vorzugehen und einen kleinen Bereich der Erfahrung mit einem bestimmten Begriff zu belegen, sodass man diesen für sich reklamieren kann. Gleichzeitig impliziert eine solche Strategie aber auch, dass man in Reduktionismen hineingeraten kann und Dissense ausgetragen werden, die nicht zielführend sind, wenn es um eine deskriptiv reichhaltige, epistemologisch adäquate und möglichst unvoreingenommene Bestimmung von Phänomenen subjektiven und intersubjektiven Erlebens wie der Empathie geht.
Wie das Beispiel der Geburtstagsparty verdeutlicht, werden unsere empathischen Fähigkeiten in alltäglichen Situationen ständig und auf vielfältige Weise in Anspruch genommen. In die Artikulation von Empathie gehen dabei diverse Faktoren mit spezifischen funktionalen Rollen ein. Empathie ist ein zeitlich ausgedehnter, dynamischer, episodischer Prozess, in den Erlebnisse aus unterschiedlichen Bewusstseinssphären (Wahrnehmen, Sich-Bewegen, Fühlen, Wollen, Denken) integriert werden. Sie lässt sich nicht als punktueller mentaler Zustand isolieren (auch wenn sie aufgrund der methodologischen Voreinstellungen und der Operationalisierungen in der experimentellen Psychologie meist so untersucht und dargestellt wird). Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass sich Empathie im lebensweltlichen Sinne über unterschiedliche Referenzobjekte und Akte der intentionalen Bezugnahme erstreckt und mit habituell geprägten Schwellenwerten der Rezeptivität und Aufmerksamkeit versehen ist. Will man die zuvor genannten Aspekte der übergreifenden empathischen Erfahrung systematisch ordnen, so kann man drei Dimensionen der Empathie unterscheiden: eine leiblich-körperliche, eine affektiv-emotionale und eine kognitive (Breyer 2015).
1. In der leiblich-körperlichen Dimension lassen sich die Modi der Resonanz und der Expression als Grundformen des empathischen Geschehens aufweisen. a) Der Resonanzmodus besteht in der Fähigkeit zur Synchronisierung mit den Bewegungen anderer (Ramseyer/Tschacher 2011), wie beispielsweise bei gemeinsam ausgeführten Praktiken oder bei der Gefühlsansteckung (Hatfield/Cacioppo/Rapson 1994), wenn man unwillkürlich von der Gemütsbewegung eines anderen affiziert wird und motorische Programme aktiviert werden, die sich nur bedingt bewusst steuern lassen. Zur Synchronisierung gehört eine mimetische Kapazität, durch die wahrgenommene Ausdrücke des anderen in Eigenbewegungen umgesetzt werden (Meltzoff/Moore 1989). Diese Regungen haben ihrerseits eine Ausdrucksseite, die von anderen ebenfalls wahrgenommen wird. b) Der expressive Modus der Empathie besteht im unmittelbaren Ausdrucksverstehen (Zahavi 2011), d.h. im Gewahrsein des Zustandes, in dem sich ein anderer gerade befindet, anhand der Wahrnehmung seiner leiblichkörperlichen Ausdrücke (Mienenspiel und Gestik, aber auch Haltung, Gang und Ausstrahlung).
2. Zur affektiv-emotionalen Dimension der Empathie gehören eine ganze Reihe von Erlebnissen, die sich systematisch nach ihren jeweiligen Bezugspunkten und den Modi ihrer Bezugnahme auf den anderen gliedern lassen. Häufig wird unter dem Begriff der Empathie die a) partizipierende Bezugnahme auf den anderen gefasst, also beispielsweise die Mitfreude oder das Mitleid (Schlossberger 2013). Wenn wir uns mit jemandem freuen, so erleben wir Freude dort, wo der andere ebenfalls Freude empfindet, wobei seine Freude der Auslöser unserer Freude ist und wir uns dessen auch gewahr sind. Ebenso verhält es sich mit dem Mitleid: Wir nehmen ein Leiden am anderen war und empfinden Mitleid mit ihm und für ihn. Gegenüber diesem partizipierenden Modus gibt es aber auch – und das mag in dieser Auflistung vielleicht merkwürdig erscheinen – den b) invertierenden Modus, bei dem wir mit einem Gefühl auf den anderen reagieren, das seinem eigenen Gefühl nicht entspricht bzw. diesem antagonistisch gegenübersteht. Beispiele hierfür sind Schadenfreude oder Neid (Smith u. a. 1996). Bei der Schadenfreude haben wir eine positive Emotion im Angesicht eines negativen emotionalen Zustands des anderen: Wir freuen uns, wenn er leidet und darüber, dass er leidet. Beim Neid empfinden wir eine negative Emotion, wo der andere eine positive empfindet: Wir gönnen ihm sein Glück nicht, es macht uns unglücklich. Warum sollte man nun diesen invertierenden Modus der emotionalen Bezugnahme auf den anderen als Möglichkeit von Empathie begreifen? Es scheint zumindest im Alltagsverständnis der Empathie bzw. der häufig mit ihr gleichgesetzten Sympathie oder dem Mitgefühl zuwiderzulaufen, Phänomene wie Schadenfreude oder Neid mit Empathie in Verbindung zu bringen. Doch strukturell zeigt sich, dass die partizipierenden und die invertierenden Formen zwei Seiten einer Medaille sind. In beiden Fällen ist vorausgesetzt, was Empathie grundlegend ausmacht, nämlich einen bewusstseinsmäßigen Zugang zu Bewusstseinsmäßigem, das anderen zugehört (der traditionelle Begriff des Fremdpsychischen ist hier durchaus treffend), zu haben, unabhängig davon, in welchen Gefühlen unsererseits – ob positiv oder negativ – dieser Zugang sich ausprägt. Als dritten Modus der affektivemotionalen Dimension der Empathie lässt sich schließlich der c) stellvertretende identifizieren, wie wir ihn in der Fremdscham kennengelernt haben (Krach u. a. 2011). Bei der Fremdscham empfinden wir Scham dort, wo der andere keine Scham empfindet (beispielsweise weil er betrunken ist und sich nicht darum schert, wie andere ihn wahrnehmen). Wir nehmen dem anderen das Gefühl, das in seiner Situation unserer Ansicht nach angemessen wäre, gleichsam ab, wir übernehmen es. Anders als beim partizipierenden Modus, wo die Ursache unserer Freude in der Freude des anderen liegt, ist es beim stellvertretenden Modus die Abwesenheit eines bestimmten Gefühls beim anderen, durch die eigentümlicherweise ein solches in uns evoziert wird. Ein anderes Beispiel für eine stellvertretende Emotion wäre die Situation, in der Wut in uns aufsteigt, wenn wir das Leiden eines anderen betrachten, dieser selbst aber augenscheinlich nicht wütend ist. Das mag aufgrund seiner stoischen Gelassenheit im Angesicht eines Übels oder aber aufgrund einer Traumatisierung der Fall sein, die sprach- und ausdruckslos macht.
3. Die kognitive Dimension der Empathie umfasst a) inferentielle, das heißt auf Schlussfolgerungen basierende Prozesse der mentalen Verarbeitung sozialer bzw. fremdpsychischer Information ebenso wie b) imaginative Prozesse des Sich-Hineinversetzens in den anderen. Im ersten Fall überlegen wir eher abstrakt, wie es einer anderen Person in einer gegebenen Situation wohl ergehen mag, was sie fühlt, sich vorstellt oder auch denkt. Diese Form der Bezugnahme auf das psychische Leben des anderen geschieht auf der Basis von allgemeinen Regeln, die auf aktuell erschließbare Informationen bezogen werden. Aus der eigenen Lebenserfahrung und generalisiertem Wissen werden in Anwendung auf wahrgenommene Situationen Vorhersagen getroffen, was hinsichtlich der Erlebnisweisen und -inhalte des anderen am wahrscheinlichsten ist. Hierbei wird häufig von den Kontingenzen der gegenwärtigen Lage abstrahiert und es werden allgemeine Prinzipien aus einer drittpersonalen Perspektive in Anschlag gebracht. Dieser gedankliche Umgang mit dem Fremdpsychischen wird häufig als Theoretisierung bestimmt (Gopnik/Wellman 1994). Doch ist Wissen, das autobiographisch erworben und in gedanklichen Routinen habitualisiert ist, wirklich ein theorieförmiges Wissen? Ist es für eine Theorie hinreichend, dass Verallgemeinerungen und Vorhersagen gemacht werden? Gewiss ist ein wissenschaftlicher Theoriebegriff komplexer und anspruchsvoller. Gleichwohl ist nicht zu leugnen, dass Menschen ständig Kausalitäten zwischen Erei...