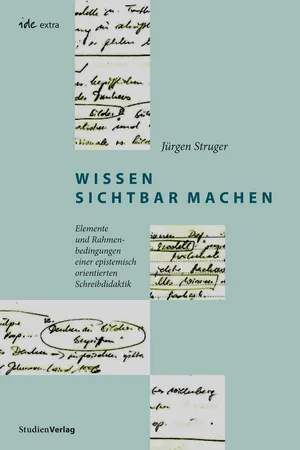![]()
1 Hintergrund und gesellschaftliche Relevanz der Thematik
In einer literal geprägten Gesellschaft kommt der Vermittlung von Schreibkompetenzen eine Schlüsselrolle zu. Eine Schreibdidaktik, die SchülerInnen auf die komplexen Anforderungen des Schreibens in Ausbildung und Beruf vorbereiten soll, muss sich ihrer Rolle im bildungspolitischen Diskurs bewusst sein und klären, auf welcher Grundlage ihre Aufgaben und Ziele zu formulieren sind. »Schreibenkönnen« ist eine komplexe, multidimensionale Fähigkeit, die auf ebenso komplexen Voraussetzungen beruht. Die Anforderungen, die in bildungspolitischen Diskursen an die Schreibdidaktik gestellt werden, sind vielfältig.
»Schreibenkönnen« als Beherrschung der normativen Anforderungen einer konzeptionellen Schriftlichkeit (im Lesen und Schreiben) ist einerseits eine Basisvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und stellt somit ein kulturelles Kapital im Sinn von Bourdieu (1983) dar. Schriftsprachliche Kompetenzen sind nicht nur eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe am Bildungssystem, sondern gewissermaßen das Schibboleth, das einen Zugang zu ökonomischem und sozialem Erfolg erst ermöglicht. Nach wie vor ist in vielen Personalagenturen die Fehlerfreiheit von Bewerbungsschreiben eines der ersten Kriterien für die Vorselektion von BewerberInnen um eine Lehrstelle. Erst wenn diese Hürde überwunden ist, ergibt sich die Chance, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Schriftsprachliche Kompetenzen sind damit Elemente einer Basisbildung, die in einem zunehmend kompetitiven Arbeitsmarkt ein wesentliches Element zur Herstellung von Chancengleichheit darstellt.
Andererseits sichert die Vermittlung einer ausgeprägten literalen Kompetenz die Handlungsfähigkeit des/der Einzelnen in einer Wissensgesellschaft, in der Wissen nicht nur erworben, sondern kritisch reflektiert und letztlich erzeugt werden soll. Schreibdidaktik soll in diesem Kontext nicht nur die Teilhabe am gesellschaftlichen Wissen ermöglichen, sondern auch die Fähigkeit vermitteln, dieses Wissen kritisch und eigenverantwortlich mitzugestalten. »Schreibenkönnen« wird damit zu einer schreibdidaktischen Bildungsaufgabe mit dem Ziel, SchülerInnen auf die Handlungsanforderungen einer komplexen Bildungslandschaft vorzubereiten. Dazu gehört neben der Beherrschung der normativen Anforderungen schriftsprachlicher Textproduktion ebenso sehr die Fähigkeit, den Umgang mit Texten, rezeptiv wie produktiv, als Medium des Lernens und Verstehens nutzen zu können.
Zunächst ist zu klären, welcher Bildungsbegriff die Basis für eine solche Schreibdidaktik sein kann. Gruber (2002) konstatiert, dass »Bildung« in einer »Wissensgesellschaft« abgelöst wurde von einem Konzept der Informationsverarbeitung und davon,
[…] dass die Leistung des Menschen in Lernprozessen darin besteht, Informationen – oder »Bits« – aufzunehmen und diese in Wissen und Können zu transferieren. Definiert man hingegen Bildung als reflektiertes Denken (und darauf aufbauendes Handeln), dann ist Bildung eindeutig mehr als Informationsaufnahme und Verarbeitung von Wissen für (berufliches) Handeln. Es enthält vielmehr die Vorstellung der Entfaltung einer Persönlichkeit mit aufrechtem Gang und freiem Entscheidungswillen, die allen menschlichen Rollen gerecht wird, nicht nur der als Erwerbstätige/r. (Gruber 2002, 7)
Gruber orientiert sich damit am Humboldt’schen Bildungsbegriff und stellt fest, dass von einer »Wissensgesellschaft«, wie sie seit den 1960er-Jahren propagiert wurde, nicht mehr die Rede sein kann, sondern vielmehr von einer »Informationsgesellschaft«, in der es nicht mehr vorrangig um Bildung gehe, »sondern darum, in möglichst kurzer Zeit aus einer möglichst großen Fülle an Informationen die jeweils brauchbarsten auszuwählen, aufzunehmen, zu verarbeiten und anzuwenden – oder andererseits neue Informationen ›zu erzeugen‹« (ebd.). Grubers Kritik zielt auf einen reduktionistischen Lernbegriff, in dem Lernen nicht als individuelle Entwicklung verstanden wird, sondern als ständige Anpassung an die Anforderungen einer Berufswelt, in der es nötig ist, sich Informationen anzueignen, um »marktgängig« zu bleiben. Die Kritik Grubers an einem solchen auf Informationsverarbeitung reduzierten Lernbegriff ist nicht nur in einem allgemeinen bildungspolitischen Kontext relevant. Die Vermittlung von Schreibkompetenz als einer gesellschaftlich relevanten Schlüsselkompetenz muss vor diesem Hintergrund reflektiert werden.
Schreiben dient als Nachweis, zur Darstellung und zur Kommunikation von Wissen und stellt somit eine grundlegende Kulturtechnik für die »Informationsgesellschaft« dar. Obgleich die formale und normangemessene Textproduktionskompetenz im schulischen Curriculum speziell bei SchreibanfängerInnen im Vordergrund steht und diese Fähigkeiten nach Absolvierung der schulischen Grundausbildung bzw. der Reifeprüfung nach wie vor essenziell sind, da sie durch mangelnde Orthografiekenntnisse und Ausdrucksmängel in Gebrauchstexten am auffälligsten und folgenreichsten sind (z. B. in Bewerbungen), wäre es problematisch, Schreibkompetenz auf diese Dimension zu reduzieren. Die Einführung von Bildungsstandards und kriterienorientierten Verfahren zur Bewertung von Schreibkompetenz fokussiert auf eben jene grundlegenden Dimensionen von Textproduktion. Die Aneignung von Schreibkompetenz als der Fähigkeit zur Herstellung von normgerechten und situativ angemessenen Texten als Basis für die Teilnahme an einer »Wissensgesellschaft« steht außer Frage. Eine Reduktion der Schreibdidaktik auf diese Funktionen des Schreibens jedoch würde den Erwerb von Schreibkompetenzen als notwendige Anpassungsleistung (im Sinne Grubers) an die Erfordernisse einer Produktionsgesellschaft verengen.
Ossner (1995) unterscheidet drei Hauptfunktionen des Schreibens: eine psychische (»Für sich schreiben«), zwei soziale (»Für andere schreiben«, »An andere schreiben«) und zwei kognitive (»Schreiben zur Gedächtnisentlastung«, »Schreiben, um Erkenntnisse zu gewinnen«) (ebd., 41 f.). Schreiben für sich, für und an andere lässt sich insgesamt als Lehr-/Lernziel im Deutschunterricht durch seine enge Verbindung zu den Lebenswelten von SchülerInnen gut fundieren. SchülerInnen schreiben viel, wenn auch in anderen Formaten, als der Deutschunterricht sie vorsieht (vgl. Struger 2009). Chats, Blogs, Foren und ähnliche Web-Formate machen Schreiben attraktiv, wenngleich die hier wahrnehmbaren Schreibkulturen sich mehr oder weniger deutlich von schulischem Schreiben unterscheiden. Die soziale Funktion von Schreiben behält durch neue Kommunikationskanäle ihre Relevanz (in »sozialen Netzwerken« u. ä.), und eine Herausforderung für die Deutschdidaktik und speziell die Schreibdidaktik ist die sinnvolle Berücksichtigung dieser erweiterten Medialität im Schreibcurriculum. Schließlich müssen formale Anforderungen kommunikativen Schreibens trotz allem für die Vorbereitung auf weiterführende Bildungswege und Berufswelt vermittelt werden. Die kognitive Funktion von Schreiben als Werkzeug zur Gedächtnisentlastung »gehört untrennbar zum Schreiben« (Ossner 1995, 41). Anders verhält es sich mit der epistemischen Dimension. »Schreiben, um Erkenntnisse zu gewinnen« stellt weder im schulischen noch im außerschulischen Schreiballtag eine Selbstverständlichkeit dar. Es ist nicht von vornherein anzunehmen, dass SchülerInnen ihre Schreibprozesse bewusst dazu verwenden, »einem Gedanken eine Gestalt zu geben« (ebd.). Ebenso ist nicht per se davon auszugehen, dass Lehrkräfte die Schreibprodukte von SchülerInnen generell als sprachliche Realisierung von Erkenntnisgewinn wahrnehmen.
Nicht oder nur teilweise im Blickfeld schulischer Schreibcurricula sind jene Aspekte von Schreibkompetenz, welche die epistemische Dimension des Schreibens betreffen, also jene Aspekte, die Schreiben zu einem Medium der individuellen Aneignung von Wissensinhalten, also von Lernen, machen. Wenn der Erwerb von Schreibkompetenzen nicht lediglich als notwendige »Reaktion auf eine von außen wirkende Herausforderung oder Not zum Zweck des besseren Überlebens« (Hentig 1996, 153) verstanden wird, sondern als Basiselement eines an Lernen und Verstehen ausgerichteten Bildungskonzepts, bedarf die Gestaltung von Schreibcurricula der Berücksichtigung dieses epistemischen Aspektes. Bildung ist damit nicht auf die Aneignung von Wissen reduzierbar, dieses wiederum nicht auf die Summe von relevanten Informationen. Vor dem Hintergrund bildungspolitischer Ansätze, die »lebenslanges Lernen« in einer »kognitiven Gesellschaft« (Europäische Kommission 1995, 3) zum wichtigsten Ziel setzen, bedarf es insbesondere in der Schreibdidaktik der Vermittlung von sprachlichen und kognitiven Kompetenzen, mit denen Informationen dargestellt, überprüft und reflektiert werden können. Zugleich bedarf es der Gestaltung eines schreibdidaktischen Rahmenkonzepts, mit dem diese Ziele systematisch und für die Unterrichtspraxis handhabbar umgesetzt werden können.
Writing-to-learn-Ansätze und Writing-across-the-curriculum-Modelle haben zu einer Konjunktur von schreibdidaktischen Methoden im Sprachunterricht und in der Folge auch im Fachunterricht geführt. Das Schreibtagebuch, das Lesetagebuch und ein Bündel an verwandten schreibdidaktischen Interventionen, nicht zuletzt das Portfolio, haben den didaktischen Blick auf Sprachkompetenz im Unterricht verändert und Schreibdidaktik nachhaltig in fachdidaktischen Diskussionen – auch unter der Berücksichtigung konstruktivistischer Perspektiven – verankert. Zu den positiven Effekten dieser Entwicklung zählt die Einrichtung von Schreibberatungseinrichtungen an Universitäten ebenso wie die Einführung von Schreibkursen, auf freiwilliger Basis oder verpflichtend, an Schulstandorten. »Schreibendes Lernen« (Bräuer 2014) ist zu einem etablierten Begriff der Schreibdidaktik geworden.
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Schreiben und Lernen mit dem Ziel, auf der Grundlage der vorhandenen Ansätze einen didaktischen Rahmen für eine epistemisch orientierte Schreibdidaktik zu entwerfen. Somit steht im Fokus der Untersuchung nicht ein Begriff epistemischen Schreibens, wie er etwa von Bereiter als ExpertInnenkompetenz verstanden werden kann, sondern vielmehr eine epistemische Ausrichtung des Schreibunterrichts, also eine Untersuchung jener Aspekte des Schreibunterrichts, welche Schreiben als Medium des Lernens, des Verstehens und der Erkenntnis betreffen. Im Zuge der Untersuchung wird ein Überblick über theoretische Konzepte von Schreiben unter epistemischer Perspektive präsentiert. Diese Konzepte werden zu einem Analyserahmen kondensiert, der auf konkrete SchülerInnentexte angewendet wird, woraus wiederum ein Kriterienraster für die Beurteilung der epistemischen Qualität von SchülerInnentexten destilliert wird.
1.1 Zur didaktischen Relevanz des Themas
Diese doppelte Rolle von Schreiben als Medium des Lernens ist weitgehend unstrittig:
Das Schreiben ist Medium des Lernens, insofern es ein ausführliches »Benagen« und »Begrübeln« von Gedanken fördert, und es ist Gegenstand des Lernens, insofern es die »Entdeckung« sprachlicher Mittel begünstigt, welche die Schaffung eines Sprachwerks […] ermöglichen. (Pohl/ Steinhoff 2010, 15)
Schreibkompetenz wird im Schreibkompetenzmodell von Becker-Mrotzek/Schindler (2007) als Interaktion von vier Wissenstypen beschrieben:
• Deklaratives Wissen: Faktenwissen, Wissen über Sachverhalte von Welt (Knowing-what)
• Problemlöse-Wissen: Methodisches Wissen zur Erkenntnisgewinnung (Knowing-how)
• Prozedurales Wissen: Zu Prozeduren und Routinen verdichtetes Wissen, der Übergang zum Problemlösewissen ist fließend
• Metakognitives Wissen: Bewusstheit des eigenen Tuns in einem Gegenstandsfeld und der eigenen Stellung zu diesem Gegenstandsfeld und zu diesem Tun, oder anders ausgedrückt, die Fähigkeit, das eigene Handeln und die eigene Kognition zum Gegenstand des Wissens und Nachdenkens zu machen. (Becker-Mrotzek/Schindler 2007, 9 f.; Hervorh. J. S.)
Unter Problemlösewissen verstehen Becker-Mrotzek/Schindler alle Verfahren, »die der systematischen Herstellung eines Textes dienen« (ebd., 14). Problemlösung bedeutet hier also die Lösung des Problems, eine gegebene Aufgabenstellung in adäquater sprachlicher Form zu bearbeiten. Metakognitives Wissen umfasst bei Becker-Mrotzek/Schindler alle Prozesse, »die den Schreibprozess sowie den Text in seinen unterschiedlichen Aspekten zum Gegenstand der eigenen Kognition« (ebd.) machen und damit sicherstellen, dass LeserInnenorientierung, angemessene Sachverhaltsdarstellung und eigene Schreibziele »in einem ausgewogenen Verhältnis stehen« (ebd., 16). Metakognition stellt damit jene kognitive Instanz dar, die es den SchreiberInnen ermöglicht, den eigenen Schreibprozess in allen Phasen einem Monitoring zu unterziehen und die Verwendung sprachlicher Strategien zum Schreibkontext und zur Schreibintention in Bezug zu setzen.
Während Becker-Mrotzek/Schindler Problemlösewissen und Metakognition speziell im Hinblick auf die Überwachung des Textproduktionsprozesses betonen, konzentriert sich der inhaltliche Aspekt hier auf die »angemessene Sachverhaltsdarstellung«, was impliziert, dass die Textproduktion einen vorgegebenen Sachverhalt versprachlicht, der »schon da« ist. An dieser Stelle gilt es, Differenzierungen vorzunehmen. Aus epistemischer Sicht ist anzumerken, dass das oben erwähnte »Benagen« und »Begrübeln« von Gedanken im Schreibprozess nicht etwa nur eine wünschenswerte Begleiterscheinung darstellt, sondern einen zentralen Aspekt von Schreiben ausmacht. Die Herstellung eines Textes zu einem vorgegebenen Sachverhalt unter spezifischen Anforderungen (Kontext, Textsorte etc.) kann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Forschungen zur Multimodalität als »Meaning Making« (siehe Kapitel 2.1), als Herstellung von Bedeutung, verstanden werden. Textproduktion ist in diesem Ansatz nicht lediglich als angemessene »Übersetzung« eines Inhaltes in eine Textform zu verstehen, sondern vielmehr als Prozess der individuellen Konstitution dieses Sachverhaltes, der erst durch seine Versprachlichung/ Vertextung eine kommunizierbare Form annimmt. Unter diesen Voraussetzungen muss Schreiben in seiner Rolle als Medium der kognitiven Verarbeitung von Wissen verstanden werden, mithin als epistemischer Prozess.
Die hier präsentierten Untersuchungen zu den Rahmenbedingungen einer epistemisch orientierten Schreibdidaktik basieren im Wesentlichen auf drei Aspekten:
1.1-1 Differenzen zwischen curricularen Ansprüchen an die Schreibdidaktik und den didaktisch-methodischen Grundlagen für ihre Umsetzung
Formal gesehen sind die aktuellsten Erkenntnisse der Schreibforschung in der Schulpraxis angekommen, objektiv und praktisch gesehen haben es nach fast 35 Jahren nicht einmal die Erkenntnisse von Hayes und Flower (1980) und Bereiter (1980) in die Schulpraxis geschafft – und wenn sie in Curricula oder didaktischen Leitbildern für Unterricht auftauchen, dann allenfalls in abgespeckter, normierter und allgemein testbarer Form. (Hansen 2014, 1)
Die kritische Diagnose des Schreibunterrichts von Hansen mag auf Widerspruch stoßen, besonders von...