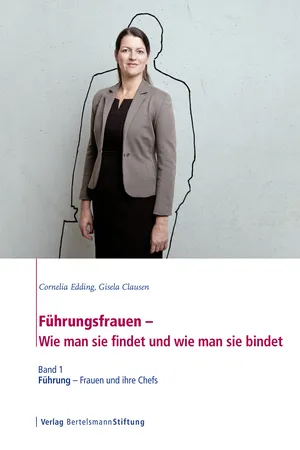![]()
TEIL II
Wünsche und enttäuschte Wünsche
„We need to replace the corporate ladder with corporate lattice.“
Anne Weisberg, Senior Advisor Deloitte
In diesem Abschnitt geht es um die Frage: Wollen Frauen überhaupt aufsteigen in einem Unternehmen? Wie wichtig ist es ihnen, Karriere zu machen im Sinne einer Aufwärtsbewegung, in der Verantwortung, Vergütung und Status stetig oder sprunghaft zunehmen? Unterscheiden sich in diesem Punkt Männer und Frauen oder möglicherweise die Frauen verschiedener Generationen untereinander? Oder verändern sich die Wünsche mit dem Aufstieg – müsste man also Frauen auf verschiedenen Stufen der Karriereleiter miteinander vergleichen?
2.1 Karrierewünsche von Männern und Frauen
Die wichtigsten Hypothesen und Hinweise
Für die Zufriedenheit von Frauen ist der berufliche Status nicht so wichtig – anders als bei Männern. Ihre Führungsmotivation ist weniger stark ausgeprägt als die der Männer, und sie ist gebrochen, d. h. nicht widerspruchsfrei. Diese Ambivalenz erscheint ganz vernünftig, denn Frauen, die Karriere machen, sind nicht selten unzufrieden. Ob sie nach vielen Berufsjahren unzufriedener sind und mehr Schaden genommen haben als Männer, ist unklar. Die Befragung der Studentinnen und Studenten in drei der oben geschilderten Umfragen ergibt ein etwas verschwommenes Bild. Es entsteht der Eindruck, als gingen Männer und Frauen mit einer unterschiedlichen Haltung ins Berufsleben. Die Berliner Absolventinnen sind weniger karriereorientiert als ihre Kommilitonen. In der schwedischen Umfrage quer durch Europa sind die Karrierewünsche der Männer ausgeprägter als die der Frauen. Und auch bei der kanadischen Gruppe war den Männern die Möglichkeit zu Aufstieg und Entwicklung wichtiger als den Frauen. Allerdings sind die Unterschiede in allen Fällen nicht sehr groß.
Karrierefaktor Gehalt
Es scheint, als seien Frauen finanziell leichter zufriedenzustellen. Dafür sprechen die oben erwähnten Umfrageergebnisse zum Thema Gehalt – immer erwarten Frauen deutlich weniger als Männer (und sie bekommen auch weniger). Sind die Frauen damit am Ende doch unzufrieden?
Mayrhofer et al. (2005) unterscheiden in ihrer Langzeitstudie zwischen subjektivem und objektivem Karriereerfolg.
Den objektiven Erfolg messen sie am Gehalt und an der Anzahl der unterstellten Mitarbeiter, den subjektiven an der Selbsteinschätzung und der Einschätzung durch das berufliche Umfeld. In ihrer Langzeitstudie, dem „Vienna Career Panel Project“, haben die Autoren unter anderem die Karriereentwicklung von 52 „virtuellen Zwillingspaaren“ zehn Jahre lang verfolgt. Diese unterschieden sich in ihrem Geschlecht; andere Merkmale wie Herkunft, Studienerfolg, Persönlichkeitsmerkmale waren weitestgehend vergleichbar.
Schon nach drei Jahren differierten Männer und Frauen deutlich im Gehalt und im Umfang der Führungsverantwortung (Zahl der Mitarbeiter), aber nicht in ihrer Zufriedenheit. Nach zehn Jahren betrug der Gehaltsunterschied 18.000 Euro pro Jahr, die Männer hatten im Schnitt 15, die Frauen vier Mitarbeiter.
Dennoch waren die Frauen genauso zufrieden wie die Männer. Und das berufliche Umfeld schätzte den Berufserfolg der Frauen sogar höher ein als den der Männer. Wichtig: Die Befragten wussten nichts voneinander. Maßstab für die Frauen waren daher nicht die Erwartungen der Männer, sondern die eigenen.
Karrierefaktor sozialer Status
In der Untersuchung von Trzcinski und Holst (2011) zeigt sich eine ähnliche Tendenz. Sie verglichen die Zufriedenheit von deutschen Männern und Frauen in Abhängigkeit von ihrem beruflichen Status. Die Statuskategorien waren:
niedrige Managementposition nicht auf dem Arbeitsmarkt Die Autorinnen nutzten die Daten von 20.000 Personen aus dem Socio-Economic Panel (SOEP) in Deutschland der Jahre 2000 bis 2007. Für Männer ergab sich eine klare Abhängigkeit: Je höher ihr beruflicher Status, desto zufriedener waren sie mit ihrem Leben – die Manager waren am zufriedensten, die Arbeitslosen am unzufriedensten. Bei den Frauen sah das Bild ganz anders aus: Hier waren nur die Arbeitslosen signifikant unzufriedener. Alle anderen unterschieden sich nicht – ob sie nun hohe Managementpositionen innehatten oder dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung standen.
Trzcinski und Holst meinen, ein größeres Interesse von Frauen an Leitungspositionen sei nicht zu erwarten, wenn junge Frauen sehen, dass ältere und erfolgreiche auch nicht zufriedener sind als sie selbst. Die Autorinnen plädieren dafür, die nicht pekuniären Anreize von Managementpositionen zu erhöhen, um sie so für Frauen attraktiver zu machen.
Karrierefaktor Führungsverantwortung und Führungsmotivation
Zum Erklimmen der Karriereleiter gehört die Übernahme von Führungsverantwortung. Eine Fülle von Literatur beschäftigt sich mit den Fragen „Wie führen Frauen, wenn sie führen?“, „Führen sie anders, besser, schlechter?“. Einen Überblick über den neuesten Stand hierzu bietet Krell (2012).
Zu der Frage „Wollen Frauen überhaupt führen?“ gibt es widersprüchliche Aussagen.
In der Befragung von Universum möchten sie es weniger dringend als die Männer. Auch Mayrhofer et al. (2005) finden das Persönlichkeitsmerkmal „Führungsmotivation“ bei Frauen geringer ausgeprägt. Auf der anderen Seite ergibt die Befragung des Families and Work Institute (FWI) im Jahre 2008 zum ersten Mal, dass genauso viele Frauen wie Männer eine Aufgabe mit mehr Verantwortung übernehmen würden. Bis dahin hatten sich in der alle fünf Jahre durchgeführten Umfrage Männer und Frauen in diesem Punkt stets unterschieden (2008 National Study of the Changing Workforce Survey). Man kann gespannt sein auf die Ergebnisse der nächsten Umfrage 2013!
Eine neuere Arbeit von Elprana et al. (2011) greift das Thema „Führungsmotivation“ wieder auf. Sie fragt danach, ob Unterschiede in der Persönlichkeit dazu beitragen, dass Frauen weniger gern Führungsverantwortung übernehmen möchten. Die Autorinnen wollten herausfinden, welche Bedeutung die Motivation in der Erfolgstrias „Kompetenz – Rahmenbedingungen – Motivation“ hat und wie sich Männer und Frauen in diesem Punkt unterscheiden. Sie wollten außerdem ein Gender-sensitives Messinstrument entwickeln.
Sie begannen mit einer bundesweiten Interviewstudie – 30 Männer und 20 Frauen. Dabei fanden sie – nicht ganz überraschend – ein größeres Vertrauen der Männer in ihre Fähigkeiten, während die Frauen ihren Erfolg eher von äußeren Umständen abhängig machten (externale Attribution). Daher, so die Autorinnen, sei Führungsmotivation für Frauen noch wichtiger als für Männer.
Diese besteht laut Elprana et al. aus drei Bausteinen: den Basismotiven (Macht, Leistung, soziale Einbindung), verschiedenen Erlebnisqualitäten, die mit Führung verbunden sind (affektiv, kalkulativ, normativ), und konkreten Interessen, die in einer Führungsposition befriedigt werden. Frauen haben den Ergebnissen dieser Studie zufolge eine von Ambivalenzen gekennzeichnete Führungsmotivation.
Besonders häufig ist der Widerspruch zwischen dem Wunsch, Führung zu übernehmen, und der Sorge, dabei zu versagen (32 Prozent der Frauen vs. 18 Prozent der Männer). Erst wenn sich die Frauen von einer Mentorin oder einer gleichgestellten Kollegin unterstützt fühlten, schwand dieser Widerspruch. Häufig misstrauen Frauen auch der Möglichkeit, Familie und Führungsaufgabe befriedigend zu verbinden. Einer der vier Motivationstypen, die Elprana et al. erarbeiteten, ist besonders kennzeichnend für Frauen:
„Die Personen in diesem Cluster streben vergleichsweise stark nach Einfluss und Leistung, neigen jedoch gleichzeitig stärker zu Vermeidung von Kontrollverlust und Misserfolg. Das bedeutet, es gibt ...