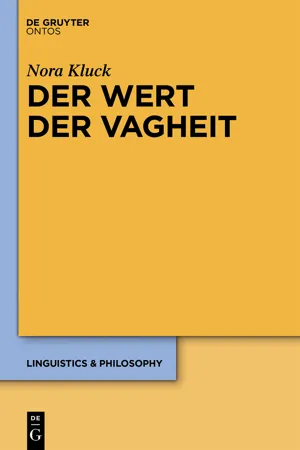![]()
1 Einleitung
Kojak-Darsteller Terry Savalas ist ein klarer Fall von einem Glatzkopf, ebenso Mahatma Gandhi. Bob Marley ist ein klarer Fall von einem Nicht-Glatzkopf.
Stellen wir uns eine Reihe von Männern mit unterschiedlich reicher Haarpracht vor, beginnend bei Bob Marley. Dessen Reihennachbar hat genau ein Haar weniger auf dem Kopf als der Reggaesänger. Der Nächste in der Reihe hat noch ein Haar weniger auf dem Kopf. So wird die Reihe fortgesetzt; es ist immer ein einziges Haar weniger vorhanden. Wir streifen also, wenn wir an der Reihe entlang gehen, etwa Götz Alsmann, Albert Einstein, Alfred Hitchcock und Homer Simpson, bis am Ende der Reihe schließlich Terry Savalas steht, der kein einziges Haar auf dem Kopf hat. Wir haben mit einem klaren Fall von Nicht-Glatzkopf begonnen und enden mit einem klaren Fall von Glatzkopf. Die Frage ist nun: An welcher Stelle haben wir den Bereich erreicht, in dem wir das Prädikat „Glatzkopf“ mit Sicherheit anwenden konnten?
War es bereits der Übergang von Bob Marley zu seinem Nachbarn? Ganz sicher nicht: In beiden Fällen haben wir es eindeutig mit Nicht-Glatzköpfen zu tun. Dass nach dem ersten Schritt ein Haar weniger vorliegt, können wir mit dem bloßen Auge noch nicht einmal erkennen. Daher kann ein Haar mehr oder weniger im Hinblick auf die Verwendung des Prädikats „Glatzkopf“ (bzw. „Nicht-Glatzkopf“ für einen Sprecher keinen Unterschied machen.
Dies gilt genauso für den Übergang von Reihennachbar 1 zu Reihennachbar 2 und von Reihennachbar 2 zu Reihennachbar 3 etc.: Ein Haar mehr oder weniger kann keinen Unterschied machen, ob man jemanden als „Glatzkopf“ bezeichnet oder nicht.
Doch nicht erst am Ende der Reihe, bei Terry Savalas, wird deutlich, dass das Festhalten an der Zuschreibung „Nicht-Glatzkopf“ der gewöhnlichen Verwendung des Prädikats nicht entspricht. Terry Savalas ist ein eindeutiger Fall von Glatzkopf. Dies trifft allerdings auch schon auf denjenigen zu, der nur ein Haar mehr auf dem Kopf hat als er, oder drei, wie Homer Simpson. Denn auch hier gilt: Ein Haar mehr oder weniger kann keinen Unterschied machen.
Da ein Haar mehr oder weniger keinen Unterschied machen kann, liegt die Grenze zwischen „Glatzkopf“ und „Nicht-Glatzkopf“ offenbar nicht zwischen zwei Reihennachbarn. Stattdessen liegt ein Grau- oder Grenzbereich vor: Der Übergang ist fließend und es gibt Fälle, in denen es fraglich ist, ob der Fall eines „Glatzkopfs“ vorliegt oder nicht. Diese Grenzfälle sind allerdings wiederum nicht scharf abgegrenzt von den klaren Fällen und den klaren Nicht-Fällen.
Damit ist „Glatzkopf“ ein vages Prädikat. Der Begriff, den es bezeichnet, hat keine scharf abgegrenzte Extension und lässt daher Grenzfälle zu. Er ist (semantisch) vage.
Semantische Vagheit führt auf formallogischer Ebene zu Problemen. Eines davon ist die Sorites-Paradoxie, die auch im hier genannten Beispiel vorliegt:
Trotz wahrer Prämissen („Bob Marley ist kein Glatzkopf.“) und eines gültigen Schlussschemas („Wenn jemand ein Haar weniger auf dem Kopf hat als ein Nicht-Glatzkopf, ist auch er ein Nicht-Glatzkopf. Denn ein Haar macht im Hinblick auf die Zuschreibung des Prädikats ‚Glatzkopf‘ keinen Unterschied. “) kommt man zu einer inakzeptablen Konklusion („Kojak-Darsteller Terry Savalas ist kein Glatzkopf.“). Ein anderes Problem ist die Wahrheitswertzuweisung von Propositionen, die ein vages Prädikat enthalten, das sich auf einen Grenzfall bezieht: Wenn wir einen Mann aus der Mitte unserer Reihe, also aus dem Graubereich, herausgreifen und über ihn aussagen: „Dieser Mann ist ein Glatzkopf“, verlangt die klassische zweiwertige Logik, dass diese Aussage als „wahr“ oder „falsch“ beurteilt wird. Dies ist hier jedoch nicht ohne weiteres möglich: Der Sprecher kann sich selbst unsicher sein, wie er die Aussage bewerten soll. Er kann auch zu verschiedenen Zeitpunkten verschieden urteilen oder zwei Sprecher können sich darüber uneins sein – ohne dass ihnen dies vorwerfbar wäre (intersubjektive Variabilität). Denn der Begriffsumfang ist nicht scharf begrenzt und daher gibt es für viele Fälle keine eindeutige Antwort, ob ein Gegenstand noch unter den Begriff fällt oder nicht (und damit mit dem entsprechenden Prädikat bezeichnet werden kann).
All dies sind Gründe dafür, dass semantische Vagheit aus formallogischer Perspektive für defizient gehalten wird. In der Literatur findet sich eine Fülle von Ausführungen zu Vagheit als einem Defekt (freilich nicht des einzigen) natürlicher Sprachen.
Indessen sind fast alle Prädikate der natürlichen Sprachen vage. Bei genügend langem Nachdenken lässt sich für fast jedes Prädikat ein Grenzfall konstruieren. Und dennoch funktioniert die Kommunikation in der Alltagssprache mit eben jenen Prädikaten meistens sehr gut, und zwar auch dann, wenn es um Grenzfälle geht. Auch der Sprachwandel hat bisher nicht zu einer Elimination von Vagheit geführt – was zu erwarten wäre, wenn Vagheit die Alltagskommunikation massiv behindern würde.
Es liegt nahe, hieraus den Schluss zu ziehen, dass Vagheit den alltäglichen Sprachgebrauch nicht nur nicht behindert, sondern ihm sogar zuträglich ist. Daher wird in der vorliegenden Arbeit der Wert und Nutzen semantischer Vagheit systematisch aufgezeigt. Eine solche Untersuchung ist ein Desiderat der bisherigen Forschung – sowohl in der Philosophie als auch in der Sprachwissenschaft sowie in den angrenzenden Wissenschaften. Obwohl in der Literatur beiläufig und in einzelnen Sätzen immer wieder auf den Nutzen der Vagheit verwiesen wird, fehlt eine Systematisierung bisher völlig.
Die Überlegungen nehmen dabei folgenden Gang: In Kapitel 2 wird das Phänomen der semantischen Vagheit zunächst analysiert und auf das Grundproblem der Kategorisierung zurückgeführt. Es wird eine Definition von semantischer Vagheit gegeben und es werden Abgrenzungen zu verwandten Phänomenen vorgenommen. Zudem wird die Frage gestellt, welche Entitäten überhaupt vage sein können.
dp n="13" folio="3" ?
In Kapitel 3 werden Vagheitsprobleme und deren Lösungsversuche vorgestellt. Für die verschiedenen Probleme, die Vagheit aufwirft (unklare Begriffsanwendung, logische Probleme, Paradoxien, höherstufige Vagheit und das Argument der schiefen Ebene), sind schon sehr viele unterschiedliche Lösungsansätze vorgeschlagen worden. Die bekanntesten sind die drei- und mehrwertigen Logiken, der Supervaluationismus, die epistemische Theorie, der Kontextualismus und der Nihilismus.
In der Philosophiegeschichte finden sich schon verschiedentlich Bemerkungen zum Nutzen der Vagheit. Diese historischen Positionen, die sich mit den Namen Frege, Peirce, Black, Hempel, Wittgenstein, Waismann, Quine und Schaff verbinden, werden in Kapitel 4 erörtert und dem in der Philosophiegeschichte ebenfalls verfolgten Ziel der idealen Sprache gegenübergestellt.
In Kapitel 5 wird gezeigt, wie die Vagheit von Prädikaten bereits im Erstspracherwerb des Menschen angelegt ist: Lernen durch Ostension, die Unerforschlichkeit der Referenz, die geringe Größe des präsentierten Extensionsausschnitts und das Lernen an Prototypen bewirken, dass Prädikate nicht mit scharfen Grenzen erlernt werden.
In Kapitel 6 wird der These nachgegangen, dass vage Prädikate der menschlichen Wahrnehmung und der menschlichen Kognition eher entsprechen als präzise. Denn durch sie wird der Sprecher nicht gezwungen, Unterscheidungen zu treffen, die er mit seinen Sinnesorganen oder in seinem Gedächtnis nicht ohne Hilfsmittel treffen kann. Dieser Vorteil wird anhand von Farbprädikaten deutlich gemacht.
Welchen Nutzen Vagheit in konkreten Situationen der Alltagskommunikation hat und wie mit ihr umgegangen werden kann, wird in Kapitel 7 aufgezeigt. Zunächst geht es um die Rolle der Vagheit bei der Befolgung der Griceschen Konversationsmaximen. Anschließend wird erläutert, inwiefern Vagheit zur kommunikativen Ökonomie, Flexibilität und zum Bedeutungswandel sprachlicher Ausdrücke beiträgt. Thema ist zudem die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Präzisionsstandards: Es wird zu zeigen sein, dass Vagheit zu einem alltagsangemessenen Präzisionsniveau führt. Zudem wird gezeigt, wie Vagheit – auch wenn sie nicht als Generalität verstanden wird – strategisch nutzbar gemacht werden kann.
Unstrittig ist, dass Vagheit trotz allen Nutzens auch zu Missverständnissen und Störungen der Kommunikation führen kann. Daher wird erörtert, welche Reparaturmechanismen es gibt und wie Sprecher mit den Schwierigkeiten der Vagheit in der konkreten Kommunikationssituation umgehen.
Dabei erfordert Fachkommunikation allerdings einen anderen Umgang mit Vagheit als die Alltagskommunikation; dies wird in Kapitel 1 deutlich gemacht. Der beschriebene Nutzen der Vagheit ist in der Fachkommunikation nur eingeschränkt vorhanden; hier geht etwa Präzision vor Schnelligkeit. Daher wird in der Fachsprache an Vagheitsreduzierung gearbeitet.
dp n="14" folio="4" ?
Ein spezieller Fall von Vagheit in der Fachkommunikation wird in Kapitel 9 diskutiert: Vagheit im Recht. Während der Sprecher im Alltag sich angesichts von Grenzfällen immer auch noch durch eine Urteilsenthaltung aus der Affäre ziehen kann, ist dies einem Richter nicht möglich. Er muss beurteilen, ob etwas unter einen bestimmten Tatbestand fällt oder nicht, und zwar nicht nur ad hoc: Sein Urteil hat weitreichende Konsequenzen – etwa, ob der Angeklagte ins Gefängnis muss – und wird möglicherweise auch für spätere Urteile wieder herangezogen. Daher führt Vagheit im Recht zu Problemen; andererseits kann aber auch hier mit Aspekten der Flexibilität und Handhabbarkeit ein Nutzen der Vagheit festgestellt werden, auch wenn er nicht so eindeutig überwiegt wie in der Alltagskommunikation.
Ein Fazit schließlich resümiert die vorangegangenen Überlegungen.
![]()
2 Das Phänomen der semantischen Vagheit
Vagheit ist ein Phänomen, dem die Menschen begegnen, wenn sie den Dingen in der Welt eine sprachliche Ordnung geben. Menschen teilen die Gegenstände in der Welt in Kategorien ein. Dies kann als ein Resultat kognitiver Ökonomie verstanden werden: Nicht mehr jeder einzelne Gegenstand muss betrachtet werden, sondern durch das Wissen über seine Kategorienzugehörigkeit können unmittelbar Schlüsse auf seine Eigenschaften gezogen werden. Die zu einer Kategorie gehörenden Gegenstände können in vielerlei Hinsicht als äquivalent betrachtet werden; eine genaue Analyse des einzelnen Gegenstandes ist damit oft nicht notwendig.
Kategorien sind jedoch nicht scharf begrenzt; die Frage, anhand welcher Kriterien ein Gegenstand einer Kategorie zugeordnet werden kann, ist das Grundproblem der Kategorisierung (Kapitel 2.1), das im Folgenden skizziert wird. Es dient als Grundlage für die Definition von semantischer Vagheit, die anschließend aus der Sorites-Paradoxie entwickelt wird (Kapitel 2.2). Vagheit wird hier als eine Eigenschaft sprachlicher Ausdrücke (Prädikate) definiert; dies wi...