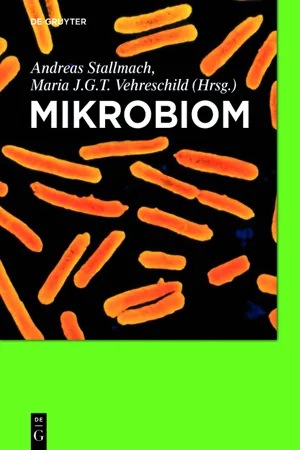![]()
Andreas Stallmach und Maria Vehreschild
1Einleitung
Seit vielen Jahrzehnten ist bekannt, dass der Magen-Darm-Trakt mit Bakterien, Viren, Pilzen und Parasiten Trillionen von Mikroorganismen beherbergt, die zusammengefasst als die gastrointestinale Mikrobiota bezeichnet werden. Vor der Geburt ist der Mensch noch weitgehend ohne Mikrobiota. Zwar erfährt der Fötus bereits über die Plazenta einen Kontakt mit bakteriellen Antigenen der Mutter, doch die erste substantielle Kolonisierung wird durch den Modus des Geburtsvorgangs bestimmt. Kinder, die per sectio entbunden werden, übernehmen ihre erste gastrointestinale Mikrobiota aus dem Hautmikrobiom der Mutter. Sie weisen eine verringerte Anzahl von Bakterien der Gattung Bacteroides und Bifidobacterium im Vergleich zu Kindern auf, die vaginal geboren wurden. Mit der ersten Nahrung entwickelt sich dann ein rudimentäres Mikrobiom mit einer noch zunächst begrenzten Anzahl von Bakterienspezies. Mit zunehmendem Alter tauchen immer neue Spezies auf, und aerobe Bakterien werden durch fakultativ aerobe und anaerobe Arten ersetzt. Die Dynamik bei der Entwicklung des Mikrobioms variiert dabei erheblich bei einzelnen Kindern. So gibt es Phasen mit raschen Änderungen in der Zusammensetzung der Bakterienspezies, denen Phasen relativer Stabilität folgen. Der Übergang zwischen den Entwicklungsphasen kann ganz plötzlich auftreten und muss keiner äußeren Ordnung folgen.
Der erwachsene Mensch beherbergt im Gastrointestinaltrakt ca. 1,5 kg Biomasse, deren Hauptanteil Bakterien bilden. Dabei liegt die Zahl der Bakterien des gastrointestinalen Mikrobioms in unserem Körper mit 1012–1014 etwa 10- bis 100fach höher als die Gesamtzahl aller humanen Zellen mit 1011. Protozoen und Viren sind dabei noch nicht mitgerechnet und bisher auch nur schlecht charakterisiert. Noch deutlicher wird diese numerische Dominanz, wenn wir die Gene der Mikrobiota, das gastrointestinale Mikrobiom, betrachten. Hier beträgt das Verhältnis zwischen Mensch und Mikrobiom ca. 1 : 10.000.
Kaum ein anderes Thema der Biomedizin hat in der letzten Dekade unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit so stark beeinflusst wie die humane Mikrobiota. Besonders durch das Human Microbiome Project (HMP) hat die Mikrobiota-Forschung in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. In bisher mehr als 20.000 wissenschaftlichen Publikationen wurden die neuen Erkenntnisse beschrieben. Fast banal klingt, dass die gastrointestinale Mikrobiota wesentlich an der Verdauung von Nährstoffen beteiligt ist, für Immunfunktionen eine wichtige Rolle spielt und metabolische Funktionen und Signalwege aus dem Gastrointestinaltrakt zu anderen Organen einschließlich Leber, Muskulatur und Zentralnervensystem beeinflusst. Wichtig ist aber auch darauf hinzuweisen, dass der Mensch selber das Mikrobiom beeinflusst. So haben z. B. genetische Faktoren einen starken modulierenden Einfluss auf die Mikrobiota. Die Probleme im Verständnis der Mikrobiota bzw. die Fragen zum Mikrobiom reflektieren somit die klassische „Henne-oder-Ei-Problematik“ in der Wissenschaft.
Da der Großteil der humanen Mikrobiota den Gastrointestinaltrakt kolonisiert, verdient dieses Ökosystem sicherlich besondere Aufmerksamkeit. Es besteht aus einer größeren Anzahl verschiedener Bakteriengattungen, von denen Firmicutes und Bacteroidetes die wichtigsten Gruppen bilden. Interindividuell kann die Zusammensetzung der bakteriellen Flora insbesondere auf Speziesebene deutlich variieren. Vor einigen Jahren wurde die Hypothese aufgestellt, dass sich menschliche Mikrobiome trotz ihrer großen interindividuellen Unterschiede einem sogenannten Enterotyp zuordnen lassen. Die initial beschriebenen drei verschiedenen Enterotypen Bacteroides spp. (Enterotyp 1), Prevotella spp. (Enterotyp 2) und Ruminococcus (Enterotyp 3) zeichneten sich durch eine Abundanz der jeweils namensgebenden Spezies aus. Allerdings werden die tatsächliche Existenz und Relevanz dieser Enterotypen mittlerweile wieder kontrovers diskutiert, dies betrifft insbesondere den Enterotyp 3.
Der Wissensgewinn in diesem Bereich wird durch die Tatsache erschwert, dass das gastrointestinale Mikrobiom einer unkomplizierten, direkten Probenentnahme nur schwer zugänglich ist. Des Weiteren variiert seine Zusammensetzung in verschiedenen Abschnitten wie Magen, Dünn- und Dickdarm. Auch unterscheidet sich die luminale Mikrobiota von der direkt der Mukosa adhärenten Mikrobiota. Um diese Problematik zu umgehen, werden zurzeit parallel eine Fülle von Asservationsmöglichkeiten – von Stuhlproben über Darmbiopsien und Rektalabstriche – erprobt. In ähnlichem Maße divers gestalten sich die Möglichkeiten zur DNA-Extraktion und Sequenzierung. Einst galten die vom HMP in 2013 veröffentlichten Protokolle zur Probengewinnung, Verarbeitung und Analyse für Mikrobiomstudien diesbezüglich als Goldstandard, doch diese entsprechen schon jetzt nicht mehr den aktuellen technischen und wissenschaftlichen Standards, sodass in der Regel jedes Institut seine eigene optimierte Version einer Analysepipeline vorhält. Da sich die Situation in Bezug auf die anzuschließenden bioinformatischen und statistischen Analysen ähnlich verhält, ist die Vergleichbarkeit von Ergebnissen aktuell nicht oder nur in stark eingeschränkter Form gegeben.
Wie viele andere aktuell erscheinende Arbeiten können auch die in diesem Buch zusammengestellten Beiträge nur einen partiellen Eindruck von der Menge und Komplexität der Funktionen der humanen Mikrobiota vermitteln. Durch die Produktion unzähliger Metabolite bleiben ihre regulatorischen Fähigkeiten nicht ausschließlich auf lokale Interaktionen, z. B. mit den auf Haut und Schleimhäuten ansässigen Zellen des Immunsystems, begrenzt. Vielmehr ergeben sich durch diese Botenstoffe unzählige Möglichkeiten der Interaktion mit allen Organen des menschlichen Körpers. Ähnlich wie bei der Erforschung des zentralen Nervensystems stellt uns ein derart vielschichtiges Netzwerk, dessen Systematik keiner uns bisher bekannten Logik zu folgen scheint, vor immense Herausforderungen. Diese Komplexität spiegelt sich aktuell auf allen Ebenen der Analytik wider. Zwar hat sich durch die deutlich verbesserte Verfügbarkeit des Next-Generation-Sequencing (NGS) einer größeren Zahl von Wissenschaftlern das Forschungsgebiet Mikrobiom eröffnet, doch dieser Prozess verläuft bisher noch in relativ ungeregelten Bahnen. Hier erscheint eine weltweite Prozessharmonisierung dringend notwendig und sinnvoll. Auf der Ebene der Metabolomanalyse wurde ein entsprechender Konsensusprozess mit der Gründung der Metabolomics Standard Initiative in 2004 bereits eingeleitet, doch auch in diesem Bereich erschwert der rasante technologische Fortschritt die Erstellung allgemein-gültiger Leitlinien zur Analyse. Historisch ist das Gebiet der Metabolomicsforschung nicht aus der Forschung zu der Mikrobiota erwachsen, sondern hat sich parallel dazu entwickelt. Entsprechend qualifizierte Forscher sind daher meist nicht primär auf die Mikrobiomforschung fokussiert. Bedenkt man nun, dass schon für die Umsetzung einer klassischen Mikrobiomanalyse mehrere Kooperationspartner notwendig sind (die Probanden/Patienten, betreuenden Ärzte, Mikrobiologen, Bioinformatiker und Statistiker), so wird klar, dass die Integration einer Metabolomicsanalyse die Projektorganisation noch deutlich verkomplizieren kann. Die Situation wird auch dadurch erschwert, dass die hohe Nachfrage nach Kooperationspartnern im Metabolomicsbereich aufgrund der aktuell exponentiell ansteigenden Anzahl an Mikrobiomstudien kaum ausreichend gedeckt werden kann. Ein ähnliches Verhältnis von Angebot und Nachfrage besteht ebenfalls im Bereich der Bioinformatik. Perspektivisch scheint hier ein weiterer Ausbau der Forschungslandschaft hin zu Zentren oder Netzwerken, die eine Expertise für alle erforderlichen Untersuchungen vorhalten können, ratsam.
Die bisher noch eingeschränkte Vernetzung von Mikrobiotaanalyse und den Möglichkeiten der modernen Metabolomicsanalysen ist mit einer deutlichen Einschränkung der Erforschung von Kausalzusammenhängen verbunden. Die reine Mikrobiotaanalyse ist nur in seltenen Fällen in der Lage, einen Wirkungsmechanismus aufzuzeigen, allerdings auch nur dann, wenn der Mechanismus in einer lokalen Interaktion zwischen bakteriellen und menschlichen Zellen begründet liegt. Jeder über Stoffwechselprodukte vermittelte Vorgang entzieht sich dieser Analyse. Ohne die Einbeziehung der „Metabolomicsdaten“ sind hochauflösende rein deskriptive Studien in ihrer Aussagekraft also deutlich eingeschränkt. Wir brauchen somit die Zusammenführung deskriptiver Ergebnisse mit funktionellen Studien aus einem phänotypisch gut charakterisierten Patientenkollektiv, um der Komplexität des Mikrobioms evtl. irgendwann gerecht werden zu können.
Auch wenn sich all diese strukturellen Probleme lösen ließen, bleibt ungeklärt, inwieweit unser Mikrobiom unseren Verständnisversuchen überhaupt zugänglich gemacht und komplett verstanden werden kann. Aus heutiger Sicht scheint es nur schwer denkbar, dass die Bedeutung des Einflusses komplexer Einflussfaktoren, wie z. B. unsere Ernährung, auf die Mikrobiota und das Metabolom verstanden werden kann. Trotz dieser Bedenken wird über das zufällige Entdecken hinaus die strukturierte Wissenschaft zum Mikrobiom wie jede systematische Forschung zu neuen Erkenntnissen führen. Fast jede Woche wird eine wissenschaftliche Arbeit publiziert, die eine neue Assoziation zwischen Veränderungen der gastrointestinalen Mikrobiota und verschiedenen Krankheiten beschreibt; die Liste reicht mittlerweile von „A“ wie Autismus bis „Z“ wie Zahnwurzelentzündungen. Aufgrund der Komplexität der vermeintlichen Zusammenhänge müssen diese Ergebnisse jedoch kritischer als manchmal geschehen, bewertet werden. So werden die Ergebnisse dieser Assoziationsstudien viel zu häufig in den Publikumsmedien als gesicherte kausale Zusammenhänge dargestellt, was sich derzeit jedoch nur für eine kleine Zahl von Erkrankungen belegen lässt.
Trotz dieser Einschränkung haben diese Studien auch neue therapeutische Interventionen begründet. Mit der sogenannten „Stuhltransplantation“ oder „Darmfloraübertragung“ hat in den letzten Jahren eine hocheffektive Mikrobiota-basierte Behandlung zur Therapie der rezidivierenden Clostridiumdifficile-Infektion vielerorts Einzug in die klinische Praxis gehalten. Dabei wird ein durch eine verminderte Diversität geprägtes pathologisches Mikrobiom durch das Mikrobiom eines Gesunden ersetzt. Wie nachhaltig dieser radikale Behandlungsansatz das Mikrobiom des Patienten beeinflusst, welchen Einfluss diese Maßnahme auf die Resilienz des Mikrobioms hat und ob sie auch bei systemischen Erkrankungen mit genetischer Suszeptibilität, wie. z. B. den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, langfristig mit therapeutischen Erfolgen verknüpft ist, ist Gegenstand aktueller klinischer Studien. Nicht überraschend stößt auch hier unser Krankheits- und Therapieverständnis erst einmal an die Grenzen seiner altbekannten Definitionen. Auch wenn die Bundesoberbehörde diesen therapeutischen Ansatz als „Behandlung mit einem Arzneimittel“ eingestuft hat, wird eine Zulassung per definitionem niemals möglich sein, da dieser Vorgang die Möglichkeit der Herstellung von in ihrer Zusammensetzung regelhaft reproduzierbaren Produkten voraussetzt. Eine hierdurch bedingte Verschiebung Mikrobiota-basierter Therapien in eine rechtliche Grauzone lässt sich weltweit in verschiedenen Ausprägungen beobachten. Doch durch das zunehmende Interesse pharmazeutischer Unternehmen an diesen Therapien erhöht sich der Druck hin zu einer Lösung im Sinne einer Zulassung. Möglich gemacht werden soll dies über die Entwicklung von Produkten mit einer reduzierten und definierten Art und Anzahl von probiotisch wirksamen Bakterien. Diese Entwicklung ist einerseits wünschenswert, andererseits ist eine Zulassung auch immer mit einem Patent verbunden. Wird nun die Gesamtheit des Mikrobioms betrachtet, so erscheint es in seiner Komplexität und Funktionalität einem Organ ähnlich. Das Bestreben, menschliche Organe patentieren zu lassen, würde mit Sicherheit eine differenzierte gesamtgesellschaftliche Debatte auslösen. Da es sich in diesem Fall aber „nur“ um Bakterien handelt, droht diese Debatte auszufallen.
Ein weiteres Ergebnis der Mikrobiomforschung, das bereits jetzt schon weite Kreise zieht, ist das wachsende Wissen über die Nebenwirkungen und Langzeitfolgen einer Antibiotikatherapie. Schon lange ist bekannt, dass Antibiotika einen Selektionsdruck ausüben, der die Kolonisierung mit resistenten Bakterien begünstigt. Des Weiteren waren definierte Nebenwirkungen für bestimmte Antibiotika bekannt. Mit der Fülle des nun entstehenden Wissens über die zentrale Rolle unseres Mikrobioms ergeben sich jedoch möglicherweise deutlich weitreichendere Implikationen einer Antibiotikatherapie als bisher vermutet. Dieses Wissen hat mittlerweile auch den Weg aus der Fach- in die Laienpresse und damit in das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein gefunden. Während bisher bei vielen Ärzten und Patienten die Gabe eines Antibiotikums im Zweifel meist sicherer erschien als der Verzicht darauf, vollzieht sich bzgl. dieser Wahrnehmung aktuell ein einschneidender Sinneswandel hin zum verantwortlichen Umgang mit dem menschlichen Mikrobiom. Ob der häufige Einsatz der Antibiotika auch die Erklärung darstellt, warum vor Urzeiten unser Mikrobiom wohl deutlich vielfältiger war als heutzutage, ist umstritten. Gezeigt werden konnte, dass das gastrointestinale Mikrobiom der im Amazonasgebiet isoliert lebenden Yanomamis-Indianer bis zu 10-mal so viele Arten enthält wie das der Menschen aus den USA und auch wesentlich vielfältiger ist als das von anderen Indio-Stämmen der Amazonasregion.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass insbesondere durch die Forschung der letzten Dekade die zentrale Rolle der Mikrobiota in der Physiologie des menschlichen Organismus und bei der Entstehung von Krankheiten aufgezeigt werden konnte. Die hieraus begründete und zum Teil sicherlich berechtigte Euphorie über das Potenzial des Mikrobioms lässt nun langsam ebenso einer kritischen Diskussion und Prozessoptimierung Raum. Auch wenn aufgrund der Fülle der zu verfolgenden Spuren die Versuchung groß ist, eine solche Spur auf eigene Faust zu verfolgen, scheint es ratsam, vorerst einen Schritt zurückzutreten und unsere Energien zu bündeln. Nur so können wir der hier vorgefundenen Komplexität langfristig gerecht werden. In diesem Sinne soll mit dem vorliegenden Buch zum Mikrobiom der aktuelle Wissensstand dargestellt werden, um Studierende der Biowissenschaften, Ärzte und Wissenschaften, aber auch den wissenschaftlich interessierten Laien über die wichtigen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Konzepte zu diesem „neuen Superorgan“ zu informieren.
![]()
Silke Peter
2Mikrobiom und Metagenom – Präanalytik, DNA-Extraktion und Next-Generation-Sequencing aus Stuhlproben
2.1Einführung
Die Next-Generation-Sequencing-(NGS-)Technologien haben es ermöglicht, die mikrobielle Zusammensetzung komplexer Proben in großem Maßstab zu untersuchen, und damit völlig neue Forschungsgebiete zugänglich gemacht. Gerade im Bereich der Humanmedizin ist der potenzielle Zusammenhang zwischen Darmmikrobiom und einer Vielzahl von Erkrankungen gegenwärtig Gegenstand intensiver Forschungsaktivitäten.
Um eine Mikrobiomstudie erfolgreich durchführen zu können, müssen bei der Planung eine Vielzahl von Einflussgrößen berücksichtigt werden. Insbesondere die präanalytischen Anforderungen, wie das genaue Prozedere zur Probengewinnung, der Probentransport und die Probenlagerung, müssen sorgfältig erwogen und genau festgelegt werden, da sie die Qualität der zu sequenzierenden DNA entscheidend mitbestimmen. Auch die Auswahl der DNA-Extraktionsmethode, die verwendete Sequenzierungsmethode und die Art der Datenanalyse beeinflussen die Ergebnisse der Mikrobiomstudie. Imfolgenden Kapitel soll ein Überblick über die verschiedenen technischen Aspekte gegeben werden, die bei dem Entwurf einer Mikrobiomstudie berücksichtigt werden sollten, wobei der Datenauswertung ein eigenes Kapitel im Buch gewidmet ist. In Abb. 2.1 ist der Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte einer Mikrobiomanalyse schematisch dargestellt.
Abb. 2.1: Schematische Darstellung der wichtigsten Schritte einer Mikrobiomanalyse von der Probenentnahme bis hin zur Dateninterpretation.
2.2Technische Aspekte
2.2.1 Präanalytik: Probengewinnung, Transport und Lagerung
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keinen allgemein anerkannten und breit angewendeten Goldstandard für die Durchführung einer Mikrobiom- oder Metagenomstudie. Dies führt dazu, dass ständig neue Protokolle zum Einsatz kommen, die die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener Studien erschweren. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, hatte sich das Human Microbiome Project (HMP) des U.S. National Institute of Health (NIH) zum Ziel gesetzt eine standardisierte Methodik zu entwickeln und einen Referenzdatensatz des Mikrobioms von gesunden Erwachsenen Personen erstellt. Die derzeit verfügbare Version wurde jedoch seit mehreren Jahren nicht mehr aktualisiert, sodass neue Erkenntnisse und Fortschritte im Bereich der Präanalytik und Probenverarbeitung darin noch nicht berücksichtigt sind [1].
Probengewinnung sowie Probentransport und Probenlagerung sind wichtige Einflussfaktoren bei Mikrobiomstudien. Sie können die Meng...