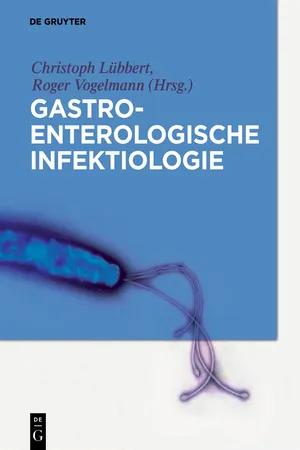
Gastroenterologische Infektiologie
- 569 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Gastroenterologische Infektiologie
Über dieses Buch
Infektionskrankheiten sind ein stetig wichtiger werdender Bestandteil der Gastroenterologie, werden in der Fort- und Weiterbildung aber bislang noch häufig vernachlässigt. Die gastroenterologische Infektiologie erfährt derzeit einen rasanten Bedeutungszuwachs durch die weitreichenden Resistenzprobleme infolge des häufig ungezielten Einsatzes von Antibiotika (insbesondere MRGN), der zunehmenden Herausforderung einer alternden Bevölkerung mit steigender Komorbidität und Infektionsanfälligkeit sowie durch die besonderen Herausforderungen von migrationsassoziierten Infektionskrankheiten. Komplexe Interventionen in der Hochleistungsmedizin mit ihren spezifischen Infektionsrisiken stellen besondere Anforderungen an das Komplikationsmanagement und die Infektionsprävention. Nicht zuletzt dürfte auch die Mikrobiomforschung neue Ansätze für das Krankheitsverständnis und die Therapiemöglichkeiten von gastrointestinalen Infektionen generieren, wie der bereits als Behandlungsoption bei rezidivierender Clostridium difficile-Infektion etablierte fäkale Mikrobiomtransfer zeigt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
1Einführung: Infektionskrankheiten in der Gastroenterologie
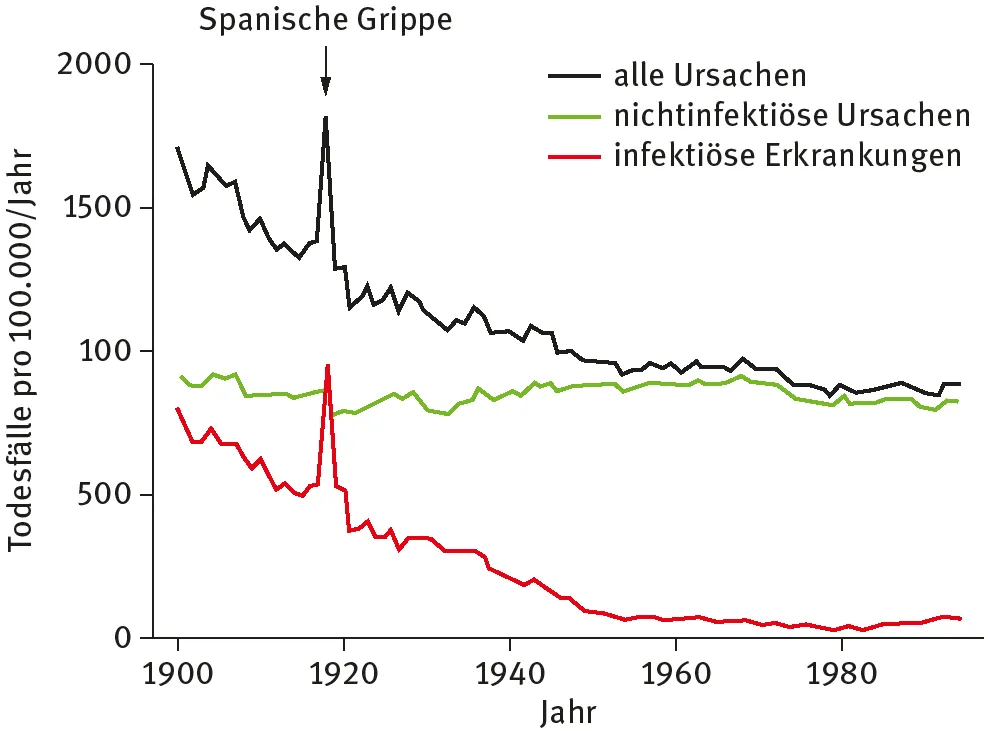

1.1 Literatur
2Für den Gastroenterologen wichtige diagnostische Verfahren, Präanalytik
2.1Bakteriologische Verfahren, Präanalytik
2.1.1Für den Gastroenterologen wichtige mikrobiologische Verfahren

Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Geleitwort
- Inhalt
- Autorenverzeichnis
- Verzeichnis der Abkürzungen
- 1 Einführung: Infektionskrankheiten in der Gastroenterologie
- 2 Für den Gastroenterologen wichtige diagnostische Verfahren, Präanalytik
- 3 Antibiotika
- 4 Antibiotic Stewardship (ABS) in der Gastroenterologie
- 5 Mikrobiom
- 6 Fäkaler Mikrobiomtransfer – Indikation und Durchführung
- 7 Helicobacter-pylori-Infektion des Magens
- 8 Infektiöse Durchfallerkrankungen
- 9 Amöbiasis
- 10 Intestinale Nematoden-Infektionen
- 11 Typhus abdominalis, Paratyphus
- 12 Morbus Whipple
- 13 Postinfektiöses Reizdarmsyndrom (RDS)
- 14 Bakterielle Fehlbesiedelung des Dünndarms
- 15 Divertikulitis
- 16 Infektiologische Besonderheiten bei CED-Patienten
- 17 Gastrointestinale Manifestation von sexuell übertragbaren Erkrankungen (STDs)
- 18 Gastrointestinale Manifestation von Herpesvirus-Infektionen (HSV, CMV)
- 19 Infektionen bei Leberzirrhose
- 20 Leberabszess
- 21 Akute und chronische Cholezystitis
- 22 Akute und chronische Cholangitis
- 23 Akute und chronische Virushepatitis – Essentials 2016/2017
- 24 Hepatobiliäre Trematodeninfektionen
- 25 Echinokokkose(n)
- 26 Akute nekrotisierende Pankreatitis und infizierte Pankreasnekrosen
- 27 Infektiologische Komplikationen der chronischen Pankreatitis
- 28 Sepsis mit abdominellem Fokus
- 29 Abdominelle Tuberkulose
- 30 HIV-Infektion
- 31 Infektiologische Besonderheiten bei Transplantierten und Immunsupprimierten
- 32 Wichtige Infektionen in der gastroenterologischen Onkologie
- 33 Pilzinfektionen in der Gastroenterologie
- 34 Vorgehen bei unklarem Fieber
- 35 Migrationsassoziierte Erkrankungen in der Gastroenterologie
- 36 Reisemedizin – woran muss der Gastroenterologe denken?
- 37 Impfprävention in der Gastroenterologie
- 38 Infektionsschutzgesetz – was muss der Gastroenterologe wissen?
- 39 Hygienemaßnahmen in der Gastroenterologie
- 40 Management von Ausbrüchen im Krankenhaus
- 41 Wichtige aktuelle Leitlinien – kurz erläutert
- Stichwortverzeichnis