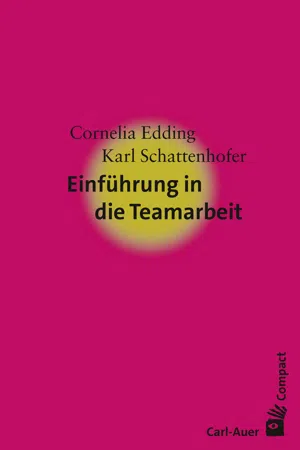![]()
1Das Teammodell im Überblick
In diesem Kapitel stellen wir unser Teammodell vor. Wir beschreiben, mithilfe welcher Unterscheidungen wir ein Team anschauen und seine innere Ordnung zu verstehen trachten. Auf diesem Konzept fußen alle weiteren Überlegungen und die Analyse der praktischen Fälle.
Auf der Suche nach der besonderen Ordnung eines Teams ist es nützlich zu überlegen, wo man überhaupt suchen könnte, in welche Richtungen zu schauen wäre und welche Fragen zu stellen wären. Dabei hilft ein Modell, das den Blick lenkt und der Suche die Beliebigkeit nimmt.
Seine wichtigsten Aspekte werden jetzt im Überblick geschildert. Eine genauere Darstellung einzelner Teile geschieht in den folgenden Kapiteln. Das Modell hat verschiedene Wurzeln: die Theorie sozialer Systeme, die Gruppendynamik und die sozialpsychologische Forschung zu kleinen Gruppen. Ein Modell, auf das wir uns schwerpunktmäßig beziehen, ist das Modell in K. Schattenhofer (1992, S. 41–66: »Gruppen als selbststeuernde und selbstreferenzielle Systeme«), ein weiteres die Theorie von H. Arrow, J. E. McGrath und J. L. Berdahl (2000, pp. 33–60: »Small groups as complex systems«); einen Überblick über die verschiedenen Stränge und die Ergebnisse der Kleingruppenforschung gibt C. Edding (2009a, S. 47–83).
1.1Drei Anforderungen an jedes Team
Jedes Team hat, wie bereits erwähnt, drei Leistungen zu erbringen, die sehr unterschiedlich sind und nicht selten zueinander in Spannung stehen, die aber immer wieder gegeneinander und miteinander auszubalancieren sind.
Zum einen hat das Team eine Aufgabe zu erfüllen, es muss eine bestimmte Arbeit leisten. Dazu wurde es gegründet oder eingerichtet.
Zum Zweiten muss ein Team seinen Mitgliedern etwas bringen, ihre Interessen und Bedürfnisse müssen in gewissem Umfang befriedigt werden, damit sie ihr Engagement und ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen. Das kann durch Geld geschehen, durch Anerkennung, das Gefühl der Zugehörigkeit, durch Erfolg u. a. m.
Und schließlich hat jedes Team die Aufgabe, sich selbst zu erhalten und zu pflegen. Dieser Systemerhalt geschieht zum Beispiel durch die Entwicklung von Strukturen und Regeln, von Normen und Rollen.
Der Prozess, in dem dies immer wieder geschieht, in dem ein Team versucht, seine Arbeit zu tun, seine Mitglieder zufriedenzustellen und sich selbst zu erhalten, bringt eine besondere Ordnung hervor. Es ist ein fortlaufender Prozess, denn die prekäre Balance zwischen den geschilderten Leistungen verändert sich, wenn Arbeitsanforderungen oder Arbeitsbedingungen sich verändern oder wenn Teammitglieder wechseln.
Das, was wir zum Zeitpunkt X als die Ordnung eines Teams wahrnehmen, ist geprägt durch seine Geschichte, seine Bemühungen, den drei Anforderungen gerecht zu werden, und die Erfahrungen, die die Teammitglieder dabei gemacht haben. Denn jedes Team hat eine Geschichte; manche haben eine kurze, überschaubare, andere eine lange, ereignisreiche Geschichte. Ob lang oder kurz, diese Geschichte ist bedeutsam; sie hat die Beziehungen geprägt und die Kultur des Teams geformt. Sie hat das Team gelehrt, wie viel Spannung die Teammitglieder aushalten können, welche Art der Leitung für sie akzeptabel ist, wie man nach einem Streit am besten weiterkooperiert und vieles andere mehr. Wie die Lebenslinie einer Person ist die Teamgeschichte durch Aufs und Abs, durch Krisen, Abbrüche, Einschnitte oder auch Phasen des Gleichmaßes gekennzeichnet. Die Geschichte ist ein prägendes Element der jetzt geltenden Ordnung.
Die Ordnung eines Teams entsteht aus:
•dem Bemühen um die Bewältigung der Aufgabe
•dem Bemühen um Zufriedenheit des Einzelnen
•dem Bemühen um den Erhalt des Systems
•und den Erfahrungen, die dabei gemacht werden (seiner Geschichte).
1.2Das Team und seine Umwelten
Teams als soziale Systeme sind in Umwelten eingebettet, von denen sie sich unterscheiden und gegenüber denen sie Grenzen ziehen und aufrechterhalten. Aus soziologischer Sicht (vgl. zuerst Homans 2013; dann z. B. Neidhardt 1979 und später, aus systemischer Sicht, Willke 1978; Simon 2014, S. 85 ff.) hat es sich als sinnvoll erwiesen, zwischen einer inneren Umwelt, wir nennen sie hier Innenwelt, und einer äußeren Umwelt zu unterscheiden. So sieht man nicht die Menschen als Elemente des Teams an, sondern die Kommunikationen, die Interaktionen, aus denen die besondere Ordnung oder die Eigengesetzlichkeit eines jeden Teams entsteht.
Die Innenwelt eines Teams wird geprägt durch die Besonderheiten und das Verhalten der Teammitglieder sowie ihre Wünsche und Befürchtungen, die sie in die Teamarbeit mitbringen. Es sind Männer oder Frauen, sie sind alt, jung oder in mittleren Jahren, sie haben eine ethnische Zugehörigkeit. Sie verfügen über berufliche Kompetenzen und Erfahrungen in der Teamarbeit, die einander sehr ähnlich oder auch sehr unterschiedlich sein können. Jedes Teammitglied prägt das Team, und jedes Teammitglied wird von ihm geprägt.
Von großer Bedeutung ist die äußere Umwelt des Teams, der Kontext, in dem es arbeitet. Aus der unmittelbaren Umwelt stammen die Aufgaben, die dem Team gestellt sind, und die Ziele, die es erreichen soll; das sind mächtige Einflussfaktoren. Auch der zeitliche Rahmen wird meist von außen gesetzt ebenso wie die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Schließlich gibt es stets auch Regeln und Gesetze, die die Spielräume des Teams bestimmen.
Jedes Team wird von seiner äußeren Umwelt und seiner Innenwelt beeinflusst – es passt sich aber nicht nur an, sondern beeinflusst seinerseits diese Umwelten, zum Beispiel durch die Art und Weise, wie es Erwartungen erfüllt.
Das Team als System kann man sich am besten als ein Kräftefeld vorstellen, in dem die Bedürfnisse und Eigenarten der Mitglieder und die Anforderungen der Umwelt aufeinandertreffen. Die soziale Dynamik, die von den Mitgliedern ausgeht, und die Aufgabendynamik, die von den Umwelten ausgeht, münden schließlich in die Art und Weise, wie das Team zusammenarbeitet und seine Aufgabe löst. Und die Ordnung, um die es uns geht, ist nichts anderes als die besondere Form der Arbeit, die das Team entwickelt hat.
1.3Wie beschreibt man die Ordnung eines Teams?
Mit welchen Begriffen lässt sich nun die Ordnung beschreiben, die in einem Team in Auseinandersetzung mit den beiden Umwelten entsteht?
1.3.1Stabilität und Dynamik, Kontinuität und Veränderung
Damit ein Team Bestand hat, bedarf es einerseits der Kontinuität und der Stabilität. Andererseits braucht es aber auch die Fähigkeit, beweglich und offen für Neues zu sein, um sich anpassen zu können, wenn die Umwelt sich verändert.
Das Stabilisierende sind die Rollen, die Normen und die Strukturen, die ein Team mit der Zeit hervorbringt, seine Routinen, seine »Sitten und Gebräuche«. So entstehen Kontinuität und Berechenbarkeit; das schafft Orientierung für die Teammitglieder und die äußere Umwelt. Zu den stabilisierenden Kräften gehören auch die Grenzen eines Teams, durch die bestimmt wird, wer dazugehört und wer nicht, welche Themen oder Verhaltensweisen eingeschlossen und welche ausgeschlossen sind. Die Grenzziehung ist nur zum Teil Ergebnis einer Vorgabe von außen. Innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen entwickelt das Team seine Grenzen selbst. Wir verstehen die Grenzziehung als eine Leistung des Teams mit Gestaltungsmöglichkeiten.
Ein Team hat thematische Grenzen, auch sie machen seine Ordnung aus: Niemals kann alles offen besprochen werden, in manchen Teams sogar nur sehr wenig. Die thematische Grenze definiert den Raum der gemeinsamen Reflexion, des Austausches über die Qualität der Arbeit und der Zusammenarbeit, der Kritik, der offenen Einflussnahme.
In jedem Team gibt es formelle und informelle Kommunikation, manche sprechen von der Vorderbühne und der Hinterbühne. Manche Themen werden auf gemeinsamen Sitzungen offen verhandelt, andere nur unter der Hand – in der Teeküche oder bei Begegnungen auf dem Flur. Was und wie viel wo besprochen werden kann, gehört zu den Charakteristika eines jeden Teams.
Zur besonderen Ordnung jedes Teams gehört auch der Unterschied zwischen formell und informell. Es gibt die offizielle Rangordnung und die inoffizielle. Es gibt die formalen Regeln und die, nach denen das Team tatsächlich handelt, es gibt die offizielle Leitung und die grauen Eminenzen. Und es gibt, wie bereits erwähnt, die öffentliche Kommunikation und das, was nur in der Teeküche besprochen wird. Wie weit klaffen in einem Team Formelles und Informelles auseinander? Wie sehr unterscheidet sich das Stück, das auf der Vorderbühne gegeben wird, von dem hinter den Kulissen?
Das Dynamische sind Konflikte, die zwischen Personen entstehen, weil sie unterschiedlich sind. Für Dynamik sorgen zudem Spannungen, die z. B. zwischen widersprüchlichen Anforderungen oder auch zwischen Bedürfnissen der Mitglieder und von außen gesetzten Bedingungen bestehen. Viele Spannungen, die ein Team beweglich und lebendig halten, werden zwar immer wieder neu geregelt, aber nicht endgültig gelöst. Wir sprechen dann von einem belebenden Konflikt. Dieser wird meist durch die äußere Teamumwelt gesetzt, zum Beispiel durch Ziele, die einander widersprechen und die daher immer wieder gegeneinander abgewogen werden müssen.
Die Ordnung eines Teams ist immer auch durch die Beziehung zwischen dem Stabilisierenden und dem Dynamischen gekennzeichnet. So gibt es zum Beispiel übergeregelte Teams, denen eine Fülle von Normen und Vorschriften die Lebendigkeit nimmt, aber auch untergeregelte, die alles immer neu aushandeln müssen und die entlastende Wirkung von Regeln und Normen nicht nutzen können.
Leitfragen zur Ordnung eines Teams:
•Welche Rollen und Normen lassen sich erkennen?
•Welches sind die thematischen Grenzen?
•Wie weit klaffen Vorderbühne und Hinterbühne auseinander?
•Gibt es einen »belebenden Konflikt«?
•Wie ist das Verhältnis zwischen Regelung und Offenheit?
1.3.2Die Steuerung des Teams
Jedes Team bedarf der Steuerung. Steuerung ist der bewusste Versuch, Einfluss auf die Teamarbeit, die bestehende Ordnung zu nehmen. Es gibt verschiedene Formen solch steuernder Einflussnahme.
Die Kontextsteuerung: Jedes Team wird beeinflusst durch Veränderungen seines Kontextes. Wenn zum Beispiel...