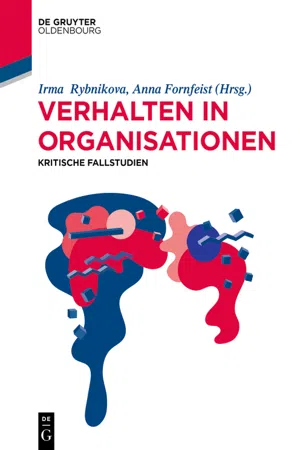1 Verhalten in Organisationen und kritische Fallstudien: eine Einleitung
Irma Rybnikova
Anna Fornfeist
1.1 Zusammenfassung
Dieses Kapitel leitet in das Buch ein und gibt eine erste Orientierung über seine Entstehungsgeschichte sowie die daraus resultierenden Besonderheiten. Es wird als ein Projekt des „forschenden Lernens“ vorgestellt, bei dem die Studierenden von den Herausgeberinnen angeleitet wurden, ihre eigenen Fallstudien zum Verhalten in Organisationen zu entwickeln und sich dabei in die ausgewählten Themen zu vertiefen. Der Fokus der Fallstudien liegt auf kritischen, also problembehafteten Themen, angefangen bei der misslungenen Arbeitsgestaltung, über die Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz bis hin zu Unfällen in Organisationen. Der kritische Bezug schlägt sich auch in der theoretischen Analyse der Fallstudien nieder, die des Öfteren auf Machttheorien zurückgreifen, um das Erlebte in Organisationen zu erklären, wie z. B. die Ressourcenabhängigkeitstheorie oder Theorie der destruktiven Führung. Dieses Buch ist nicht nur als Antwort auf den Mangel an Fallstudien im Bereich Personalmanagement und Verhalten in Organisationen entstanden, sondern knüpft auch an bisherige Ansätze der reflexiven Hochschullehre an, welche darauf abzielt, die persönlichen Erfahrungen der Lernenden als Quelle für den Erkenntnisgewinn im Managementbereich fruchtbar zu nutzen. Eine kurze Vorstellung der Inhalte der Fallstudien sowie entsprechende Nutzungsempfehlungen für die Fallstudien in der Hochschullehre bilden den letzten Teil dieses einleitenden Kapitels.
1.2 Entstehungsgeschichte des Buches
Das vorliegende Buch könnte „Fallstudienhandbuch“ heißen, enthält es doch ausschließlich Fallstudien. Und doch heißt es anders. Im Unterschied zu manch anderen Fallstudien, die im Bereich Personalmanagement und Organisation bereits existieren (z. B. Domsch, Regnet & von Rosenstiel, 2018; Böhmer, Schinnenburg & Steinert, 2012) wurden diese von den Studierenden entwickelt. An der Hochschule Hamm-Lippstadt haben die Studierenden im Rahmen der Seminare zu Personalmanagement im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre keine Fallstudien analysiert, die sie bereits vorgefunden haben, sondern eigenständig die Fallstudien als ihre Prüfungsleistung verfasst und erarbeitet.
Das Buch umfasst das Ergebnis der Leistungen im Sommersemester 2018 und 2019. Damals hießen die Seminare noch kryptisch „Seminar Personalmanagement und Organisation B“. Als eine frisch an die Hochschule berufene Professorin für Personalmanagement hat Irma nach geeigneten Fallstudien aus dem Bereich händeringend gesucht, neidisch auf die Lehrbücher und Fallstudien aus dem angelsächsischen Raum schielend, in denen Fallstudien überaus häufig zu finden und einfach zu nutzen waren. Im deutschsprachigen Raum hingegen war sie kaum fündig geworden. Entweder waren die Fallstudien nur vereinzelt in verschiedenen Lehrbüchern zu finden oder aber viel zu umfangreich, um sie in den Lehrveranstaltungen sinnvoll einzusetzen.
In dieser akuten didaktischen Not lag nichts näher, als die Studierenden nicht mehr als Ursache des Problems, sondern als die Quelle der Lösung zu erkennen. Dafür sprach auch die überaus übliche und meist kritisch bewertete aktuelle Praxis des faktischen Teilzeitstudiums: Gerade an den Hochschulen stellt das Studium nicht die alleinige Haupttätigkeit dar, meist studieren die Lernenden neben einem oder gar mehreren studentischen Jobs. Auch der Umstand, dass ein großer Teil der Studierenden im Vorfeld des Studiums eine Ausbildung absolviert hatte, sprach für zahlreiche Praxiserfahrungen, die die Studierenden bereits mitbrachten. Und mit dem Personalmanagement und Verhalten in Organisationen sammelt wirklich jede und jeder ihre oder seine Erfahrungen, sobald sie oder er spätestens einer geringfügigen Tätigkeit nachgeht.
Im angelsächsischen Raum ist es üblich, dass die Professor(innen)en sich zum Schreiben einer Fallstudie von ihrer Lehre befreien lassen und arbeiten – weiterhin bezahlt und nahezu frei von anderen Verpflichtungen – monatelang an einem einzigen Fall. Die hier enthaltenen Fallstudien sind ebenfalls innerhalb von mehreren Monaten entstanden, um genau zu sein innerhalb von vier Monaten. Lediglich haben weder die Studierenden noch wir als ihre Betreuerinnen das Privileg genossen, sich von den anderen Verpflichtungen zu befreien. Entsprechend kürzer fallen diese Fallstudien aus. Vielen von den Fallstudien würde eine ausführlichere Recherche möglicherweise guttun. Und doch stellen diese Fallstudien in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Ergebnis dar. Sie sind dabei nicht nur ein Beispiel für selbstreflexives, forschendes Lernen an den Hochschulen im Bereich Personalmanagement. Sie bringen auch eine kritische Perspektive auf das Verhalten in Organisationen zum Ausdruck, eine Perspektive, die in den bisherigen deutschsprachigen Lehrbüchern für Personalmanagement selten vertreten ist.
1.3 Fallstudien als Lehr- und Lernmethode
Die Anfänge von Fallstudien als Lehrmethode an Hochschulen gehen zurück bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. An der Harvard Law School (USA) wurden erstmals reelle Rechtsfälle für die Ausbildung angehender Juristinnen und Juristen herangezogen. Wenig später wurde diese Methode an der Harvard Business School eingesetzt und trat damit ihren Siegeszug durch die weltweiten Studienprogramme in den Wirtschaftswissenschaften an. Seither gehören Fallstudien zu einem mehr oder weniger festen Bestandteil der Managementausbildung und des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. Als besonderer Vorteil der Fallstudien gegenüber manch anderer Lehrmethoden gilt deren Praxisbezug, der eine hohe Realitätsnähe gewährleistet und damit eine praxisbezogene Vorbereitung auf den Beruf ermöglicht. Von großer lernfördernder Relevanz ist zudem der Umstand, dass in den Fallstudien Probleme in ihrer fast vollumfänglichen Komplexität dargestellt werden. Mitunter führt das zu einer beachtlichen Länge der Schilderungen. Vor allem sorgt es aber dafür, dass keine eindeutigen Lösungen für die Fälle in Frage kommen. Eine Ungewissheit über den Ausgang wohnt allen Fallstudien gewissermaßen inne. Das entspricht ganz und gar nicht der Vorstellung vom scholastischen Lernen, dessen Ergebnisse am effizientesten durch die „Multiple-Choice-Klausuren“ abzufragen sind, was – gefühlt – in zahlreichen wirtschaftswissenschaftlichen Studienprogrammen Einzug gehalten hat. Im Gegensatz dazu besteht das didaktische Ziel der Fallstudien vielmehr darin, ein reflektiertes Lernen zu ermöglichen: Lernen, welches nicht nur das Wissen vermittelt, sondern Erkenntnisse ermöglicht sowie das Nachdenken über das Lernergebnis unterstützt.
In der gegenwärtigen hochgradig volatilen Wirtschaftsumwelt werden von den Hochschulabsolvent(innen)en nicht nur die Fachkompetenzen, sondern vielmehr derartige Reflexionsfähigkeiten erwartet. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Fallstudien durchaus stark in verschiedenen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre eingesetzt werden, wie z. B. in der Logistik, Finanzwissenschaften oder Organisationslehre. Deren Einsatz in der Hochschullehre ist lediglich meist darauf beschränkt, dass die Lehrenden, und nicht die Lernenden, diese Fallstudien recherchieren, in den seltenen Fällen diese selbst verfassen und für bestimmte Lehrthemen einsetzen. Den Studierenden bleibt nicht allzu viel übrig, als die vorgegebenen Fallstudien zu konsumieren, d. h. diese zu lesen und zu diskutieren.
Im Unterschied hierzu sind die hier dargestellten Fallstudien entstanden, indem den Studierenden eine viel aktivere Rolle zugewiesen wurde: Die ursprünglichen Konsument(innen)en sollten nun selbst zu Produzent(innen)en von Fallstudien werden. Bislang überwiegt in der Managementlehre die Überzeugung, dass das Entwickeln und Schreiben von Fallstudien zu den fordernden Tätigkeiten gehört. Sie setzt vielfältige Expertise und Professionalität voraus, ist also ungeeignet für Autodidakt(innen)en oder Anfänger/-innen. Nicht selten verabschieden sich die Professor(innen)en vor allem im angloamerikanischen Hochschulraum von ihren Lehrpflichten in ein sogenanntes Forschungssemester, um ungestört an einer neuen Fallstudie zu arbeiten. Dieser tayloristisch anmutenden Aufgabenteilung zwischen den Dozierenden und den Studierenden in der Hochschullehre haben wir in den von uns organisierten Seminaren eine Abkehr erteilt. Die Entwicklung einer Fallstudie haben wir zur Prüfungsleistung erklärt und damit den Studierenden eine aktive Rolle im Lehrgeschehen auferlegt, aber nicht aufgezwungen: Die Studierenden hatten die Wahl, sich für eines der zahlreichen Parallelseminare zu entscheiden. Zugleich haben wir die Entwicklung einer Fallstudie als hochgradig geeignet angesehen, die Kompetenzziele des Moduls zu erreichen. Zu denen gehörte laut dem Modulhandbuch das Gewinnen von praktischen Einblicken in das Personalmanagement und die Organisation, das Kennenlernen der Komplexität der Problemstellungen sowie das Beziehen des theoretischen Wissens auf praktische Situationen mit dem Ziel, theoretisch begründete Lösungen abzuleiten.
Auf diese Art wagten wir einen Demokratieversuch in der Hochschullehre der Wirtschaftswissenschaften. Wir erklärten Studierende nicht zu passiven Empfänger(innen)n des für sie zunächst fremden, von uns aufoktroyierten Wissens, sondern zu Mitgestaltenden des zu erarbeitenden Wissens. Damit haben wir in Anlehnung an demokratische Organisationen (z. B. Dörre, 2015; Oestereich & Schröder, 2017) das Prinzip der Lehre auf Augenhöhe umzusetzen versucht: Studierende und Lehrende begegneten sich im Zuge der Entwicklung der Fallstudien als Kolleg(innen)en oder Genoss(innen)en der Erkenntnisse über das Verhalten in Organisationen und haben nach überzeugenden Argumenten für die nachvollziehbare Darstellung der Vorfälle gesucht sowie für eine geeignete Erklärung aus der Theorieperspektive. Gewiss bleibt dieser Versuch arg beschränkt und illusorisch, solange die Rahmenbedingungen es verlangen, dass nur die Lehrenden die Noten vergeben und diese verantworten. Eine Revolution in der Hochschullehre der Wirtschaftswissenschaften musste also ausbleiben.
Aber zumindest rückte diese Umkehr oder Umgestaltung des üblichen Lernprozesses den von uns praktizierten Ansatz in die Nähe des forschenden Lernens heran. Darunter wird im Allgemeinen die Integration von Lehre und Forschung verstanden, um durch die Lernleistung einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu erzielen (Bogdanow & Kauffeld, 2019). Die Studierenden werden hierbei angehalten, die verschiedenen Einzelphasen des Forschungsprozesses, wie die Wahl der Fragestellung, der Methode, die Thesenaufstellung und -prüfung sowie die kritische Reflexion der Ergebnisse, eigenständig zu bestimmen (Huber, 2009). In der Literatur werden verschiedene Einsatzszenarien für forschendes Lernen diskutiert, die an unterschiedlichen Forschungsphasen ansetzen, begonnen mit der Themenrecherche, über die Bearbeitung von komplexen Aufgabestellungen bis hin zur eigenständigen Erhebung der Daten mit den ausgewählten Forschungsmethoden (Bogdanow & Kauffeld, 2019).
Obwohl das wirtschaftswissenschaftliche Studium zahlreiche Anknüpfungspunkte für forschendes Lernen bietet, werden diese oft kaum umgesetzt. Die Gründe, die dazu führen, sind gewiss vielfältig wie ungeklärt. Ob das auf den dieser Disziplin innewohnenden Konservatismus zurückzuführen ist? Oder die tendenziell als Zahlenbringer für die Hochschulen geltenden Studienprogramme im Bereich Wirtschaftswissenschaften, die für permanent überfüllte Leerveranstaltungen und damit wenig Freiräume für neue Lehrinitiativen sorgen, die permanente Lehrermüdung und somit eher wenige Initiativen im Bereich forschendes Lernen erklären können? Oder die insgesamt stiefmütterlich behandelten Lehrfragen im Gegensatz zu den weitaus reizvolleren Forschungsbemühungen im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich? Wie dem auch sei, bleiben bisherige Konzepte des reflexiven Lernens in den wirtschaftswissenschaftlichen Studienprogrammen fragmentiert und unsichtbar. Dabei bieten sich nicht nur die Seminare, sondern oft obligatorische oder auch freiwillige Praktika als hervorragende, und doch wenig dafür genutzte Möglichkeiten für forschendes Lernen an der Schnittstelle zwischen der Theorie und der Wirtschaftspraxis an.
Die hier zu präsentierenden Fallstudien sind hingegen ein Ergebnis eines Experiments mit dem forschenden Lernen in den Wirtschaftswissenschaften, und zwar in Form einer Erarbeitung komplexer Aufgabensituationen, für die nicht nur eine einzige Lösung in Frage kommt. Die Entwicklung der Fallstudien ist deswegen als ein Ansatz forschenden Lernens anzusehen, weil hiermit seine wesentlichen Kriterien erfüllt werden. Die Studierenden wählen eigenständig das Thema ihrer Analyse und bestimmen selbstständig die Strategien für das Vorgehen bei der Analyse. Es besteht dabei eine grundsätzliche Ergebnisoffenheit, insbesondere hinsichtlich der theoriegeleiteten Erkenntnisse zum Thema. Zudem entspricht die Arbeitsweise den wissenschaftlichen Kriterien (Bogdanow & Kauffeld, 2019). Zugleich möchten wir an dieser Stelle hervorheben, dass ein solches forschendes Lernen keinesfalls voraussetzungsfrei ist, weder für die Studierenden noch für die Dozierenden. Auf der Seite der Studierenden setzt das Konzept eine Experimentierlust voraus und den Mut, auch aus Irrtümern und Sackgassen Erkenntnisgewinne ableiten zu können – eine Neigung und Fähigkeit, die im hochgradig verschulten Bildungssystem nicht selbstverständlich ist. Als Dozierende mussten wir erkennen, dass dieser Ansatz auch uns erheblich mehr Zeit und Mühe abverlangt hat als dies in den gewöhnlichen Seminaren der Fall ist. Insbesondere die Zeit und Muße für regelmäßiges, individuelles, bestärkendes Feedback für die Zwischenschritte der Fallstudienentwicklung erwies sich als eine Herausforderung – schlussendlich stellten die Seminare jeweils nur einen kleinen Teil des professoralen Lehrdeputats an einer Hochschule dar.
1.4 Besonderheiten der im Buch versammelten Fallstudien
Das Ergebnis des von uns umgesetzten Ansatzes für forschendes Lernen, ohne dass wir es als solches im Vorfeld betitelt haben, enthält dieses Buch. Die Studierenden wurden gebeten, eine Situation oder einen Fall ausführlich zu beschreiben und aus der Perspektive einer eigens gewählten Theorie zu analysieren, nach Möglichkeit auch Lösungen abzuleiten. Daraus gingen einige Besonderheiten der nachfolgend dargestellten Fallstudien hervor, die wir an dieser Stelle kurz reflektieren möchten.
Abgesehen von den Fallstudien zu Unfällen in Organisationen spiegeln die Fälle häufig die privaten Erfahrungen der Studierenden oder Erfahrungen aus ihrem Bekanntenkreis wider, die sie unter Anonymitätszusicherung aufarbeiten durften. Damit zeichnen sich die Fallstudien durch einen hohen Grad der Reflexivität aus. Hier schauen die Studierenden auf die Vorfälle aus einer theoretischen Distanz, versuchen, dem Leben einen theoretischen Sinn abzutrotzen und gar über die möglichen Handlungswege in den teilweise schmerzhaften Situationen nachzudenken. Auf diese Art und Weise gewinnen die Studierenden nicht nur realitätsbezogene Einblicke in Organisationen und erleben buchstäblich den heraufbeschworenen Praxisbezug, sondern werden darüber gewahr, dass scheinbar triviale Vorfälle sehr viel über Organisationen aussagen können, wenn man genauer hinschaut.
Zum anderen stellen die Fallstudien eine fruchtbare Sammlung für den Theorie-Praxis-Bezug dar. Gerade in den Wirtschaftswissenschaften, die als Disziplin seit ehedem durch Spannungen zwischen dem Anwendungs- und dem Grundlagenwissen gekennzeichnet ist, die sich auch in den Abgrenzungsversuchen zwischen den Universitäten und den Hochschulen zeigen, begleitet teilweise von politisch schmerzhaften Auseinandersetzungen, wie beispielsweise dem Promotionsrecht für Hochschulen ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen. Hochschulen sollten allgemein als rein anwendungsorientierte Ausbildungsorte gelten, Universitäten als ausschließlich am theoretischen Wissen ausgerichtete Institutionen. Der Theorie-Praxis-Bezug ist in den Wirtschaftswissenschaften kein triviales Thema. Umso weniger trivial ist es, dass die Studierenden an den Hochschulen (für angewandte Wissenschaften) lernen, mit Hilfe der Theorien zu argumentieren. In jeder Fallstudie folgt auf die Beschreibung des Falles eine kurze Darstellung der Theorie, die die Autorin oder der Autor für geeignet hielt, den geschilderten Fall zu erklären. Warum dieses Beharren auf den Theorien? Weil unserer Meinung nach mit Hilfe der Theorien das Abstrahieren von den Einzelfällen auf generelle Tendenzen und Probleme in Organisationen am besten gelingt. Weil die Theorien das Leidvolle und das Individuelle der Fälle zu reduzieren vermögen und sie statt einer persönlichen Niederlage eben wie einen Fall unter anderen erscheinen lassen und damit sowohl zur psychischen Milderung, aber auch der wissenschaftlichen Erkenntnis verhelfen.
Die Theorieanwendung ist in den Fallstudien verschieden gelungen, nicht selten stellt sich heraus, dass die gewählte Theorie nur sehr partiell der gesamten Komplexität des Falles gerecht werden kann. Und doch stellen diese umgesetzten Theorie-Praxis-Bezüge mutige und geeignete Beispiele dafür dar, wie die oft von den Studierenden an den Universitäten wie Hochschulen befürchtete Verbindung zwischen der Theorie und Praxis „geht“. Auch bieten die Fallstudien damit einen anregenden Startpunkt für weitere, differenziertere Analysen.
Eine weitere Besonderheit der hier versammelten Fallstudien besteht darin, dass sie alle in irgendeiner Art „kritisch“ sind. „Kritische“ im Sinne von „problematische“ Fälle zu suchen – das war der Auftrag an die Studierenden, um die Praxis in Organisationen nicht nur von ihrer glänzenden Seite zu betrachten, wie oft in den Lehrbüchern der Fall ist, sondern auch die Schattenseiten zu beleuchten. Diese umfassen solche Bereiche, wie Unzufriedenheit der Mitarbeitenden sowie Konflikte und Spannungen jeglicher Art. So haben wir die Studierenden darin bestärkt, Sachverhalte oder Informationen zu thematisieren, die üblicherweise unbeachtet, unbekannt oder auch nur ungern angesprochen b...