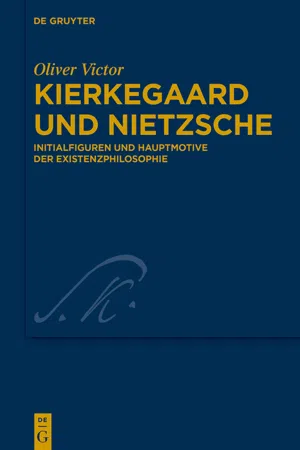1.1Einheitlichkeit und Disparatheit
Die vorliegende Untersuchung widmet sich den philosophiehistorischen Prämissen und der Genese der Existenzphilosophie, wobei Søren Kierkegaard und Friedrich Nietzsche als ihre Initialfiguren exponiert werden sollen. Dabei handelt es sich nicht um ein rein philosophiegeschichtliches Interesse, vielmehr trägt die Analyse der Entstehung einer philosophischen Strömung zu einer Verdeutlichung ihrer Konturen und Inhalte bei. Eine solche Präzisierung scheint mit Blick auf die Existenzphilosophie besonders geboten.
Die Existenzphilosophie bzw. der Existenzialismus2 bildet keine homogene, klar umrissene und von anderen Strömungen abgegrenzte philosophische Traditionslinie. So verurteilt schon Jean-Paul Sartre selbst den Versuch, den Existenzialismus zu definieren, zum Scheitern: „Ich spreche nicht gern über den Existenzialismus, denn es gehört ja gerade zum Wesen eines philosophischen Bemühens, daß es sich einer genauen Bestimmung entzieht. Es benennen oder definieren wollen, hieße, es zum Stagnieren bringen.“3 Hinter dieser Aussage verbirgt sich bereits ein bestimmtes Verständnis von Philosophie, das richtungsweisend für diese Strömung ist und zumindest der Auffassung von Philosophie als reiner Begriffsanalyse und Begriffsbestimmung entgegensteht. Bei genauerer Betrachtung erweist sich die Existenzphilosophie als Produkt einer nur unklar umrissenen Gruppe von Philosophen und Literaten, die sich selbst mehrheitlich von der Typisierung ‚Existenzphilosoph‘ distanzieren. Für Walter Kaufmann ist der Existenzialismus sogar sicherlich „not a school of thought nor reducible to any set of tenets.“4 So stellt auch Franz Zimmermann in seiner Einführung in die Existenzphilosophie gleich zu Beginn klar, so etwas wie die Existenzphilosophie gebe es nicht, verstehe man darunter ein Denken, „das an eine bestimmte Methode gebunden ist und einen durch sie explizierbaren, einheitlichen Gegenstand besitzt.“5 Und – um ein weiteres Beispiel anzuführen – Jacques Colette stellt die Einleitung seines Buches zum Existenzialismus unter die Überschrift: „Lʼexistentialisme nʼest pas une doctrine“.6 Um den Unterschied zu einer Schulphilosophie deutlich zu markieren, ist auch die Rede vom Existenzialismus als einer philosophischen Haltung7 bzw. einem geistesgeschichtlichen Klima. Die Existenzphilosophie wird demnach zuweilen explizit nicht als eine Schulphilosophie verstanden, da durch sie gerade die Unmöglichkeit einer solchen Art zu philosophieren offenbar wurde.8
Dennoch ist eine Vielzahl an Werken zur Existenzphilosophie erschienen, in denen zumindest Namen wie Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre, de Beauvoir und Camus nahezu immer als Konstanten in der Diskussion erscheinen. Es hat mitunter den Anschein, als sei es leichter, für die Existenzphilosophie relevante Denker zu nennen, anstatt eine einzelne These dezidiert dieser Strömung zuzuordnen.9 Aus systematischer Sicht erschwert dies eine Auseinandersetzung mit der Existenzphilosophie ungemein, da wir eher mit diversen Existenzphilosophinnen und -philosophen konfrontiert sind als mit einer einheitlichen Denktradition.10 Als ein gemeinsames Moment wird zwar stets der Bezug zu Kierkegaard – gemeinhin als ‚Vater‘ der Existenzphilosophie apostrophiert – und zu seinem Verständnis von Existenz angeführt. Nicht selten erfolgt dabei jedoch eine einseitige Festlegung auf Kierkegaard als die historische Referenzfigur, wobei jemand wie Nietzsche, der in dieser Arbeit einen zentralen Status einnehmen wird, oft nur am Rande Erwähnung findet.
Ein vollständiger Katalog mit essentiellen Charakteristika der Existenzphilosophie ist ebenso schwerlich anzulegen, das zeigt sich bereits an der Unterschiedlichkeit und Disparatheit der Versuche solcher Auflistungen in diversen Überblicksdarstellungen. Für manche Interpreten ist dieser Tatbestand keineswegs überraschend, da zum Beispiel nach Robert C. Solomon dem Existenzialismus nichts ferner liege als Versuche, ihn zu definieren. Allerhöchstens könne lediglich wiederum über ebendiese Versuche debattiert werden.11 Schauen wir uns zunächst exemplarisch einige einschlägige Definitions- und Konturierungsversuche aus der Forschungsliteratur an.
Das Lexikon Existenzialismus und Existenzphilosophie kristallisiert so vier Säulen heraus, die allen existenzphilosophischen Ansätzen gemeinsam seien: Es werden Kierkegaard als gemeinsame Referenzfigur, die Konzentration auf den von ihm definierten Begriff der Existenz, die Abwendung von der traditionellen Metaphysik im Sinne der Wesensphilosophie – hier wird auch häufig von der Existenzphilosophie als einem postmetaphysischen Denken gesprochen12 – und die Fokussierung auf das Individuum, den Einzelnen, aufgelistet.13 Auf diese Weise wird zwar grob umrissen, wo sich existenzphilosophisches Denken situieren lässt, letztlich bleibt eine solche Typisierung jedoch aufgrund ihrer Allgemeinheit recht vage und ist nicht einschlägig sowie trennscharf genug.
Dem Ansatz, die Existenzphilosophie über ein Spektrum von Topoi und Anliegen zu charakterisieren, folgen zahlreiche Interpreten. Kevin Aho stellt so in seinem Buch Existentialism. An Introduction immerhin sieben gemeinsame Motive heraus, die es erlauben sollen, einige Denker ausgehend von ihrer gemeinsamen Sorge „for the human situation as it is lived“,14 die nicht durch ein abstraktes System erschlossen werden könne, unter die Überschrift ,Existenzialismus‘ zu subsumieren. Genannt werden: „,Existence precedes Essence‘, ,The Self as a Tension‘, ,The Anguish of Freedom‘, ,The Insider’s Perspective‘, ,Moods as Disclosive‘, ,The Possibility for Authenticity‘, ,Ethics and Responsibility‘.“15
Die Herausgeber des Continuum Companion to Existentialism wiederum, um ein weiteres Beispiel zu nennen, verzeichnen gleich acht „major overlapping thematic concerns“16 und versuchen, den Existenzialismus unter Rekurs auf Wittgensteins Konzept der Familienähnlichkeit zu explizieren. Resümierend lassen sich jene acht Motive wie folgt aufzählen: die Fokussierung auf das konkrete Erleben in Abgrenzung zur akademischen Abstraktion; Freiheit; Tod, Endlichkeit und Sterblichkeit; ein Interesse an den Erfahrungen und Stimmungen der ersten Person; die Betonung der Verantwortung und Authentizität; die These, dass der Einzelne in der Menge untergeht bzw. verschwindet; die Zurückweisung jeglicher externen Begründungen von Moral oder Werten; der Bezug zur Phänomenologie.17
Ebenso stützt Thomas R. Flynn sich auf das Prinzip der Familienähnlichkeit und rekonstruiert davon ausgehend folgende fünf Zentralthemen des Existenzialismus: Primat der Existenz vor der Essenz, Zeit, Humanismus, Freiheit und Verantwortung sowie eine Konzentration auf ethische Fragestellungen.18
Markus Wild bezeichnet seinerseits das Interagieren und Zusammenkommen von Philosophie, Literatur, Engagement und Existenz, welches er als „existenzialistisches Quartett“19 typisiert, als charakteristisch für die Existenzphilosophie.
In einer Studie aus den 1990er Jahren gruppiert Thomas Seibert unterschiedliche Denker der Existenz (u.a. Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Foucault) unter die gemeinsamen Motive Geschichtlichkeit, Nihilismus und Autonomie. Die Disparatheit wird auch dort deutlich und durch den im Untertitel angemerkten Plural „Philosophie(n) der Existenz“20 markiert.
Fritz Heinemann, der die Einführung des Begriffs ,Existenzphilosophie‘ für sich reklamiert und in seinem Buch Neue Wege der Philosophie von 1929 die Lage der Philosophie seiner Zeit zu rekonstruieren versucht, führt die Existenzphilosophie auf folgende Grundthese zurück: „Der in Resonanz mit Menschen, All und Gott stehende Mensch ist der Schlüssel des Verständnisses der Menschenwelt, der Geschichte und des Alls selbst.“21 Hier deutet sich bereits an, dass die Genese der Existenzphilosophie mit einer Wende zum Menschen als einzelnem Subjekt und zwar in einem bestimmten Sinne, nämlich als Existierender in der Welt, der sich zu sich selbst, zu anderen und seiner Umwelt verhält, verknüpft ist. Nach den großen ‚Wenden zum Subjekt‘ in der Philosophiegeschichte (Sophistik, Augustinus, Descartes) tritt eine Philosophie in Erscheinung, die den Menschen erneut zum ‚Maß aller Dinge‘ erklärt und erhebt, ohne hier freilich die Problematik des protagoreischen homo-mensura-Satzes aufwerfen zu wollen. Somit reiht sie sich in die Reihe der Subjektivitätsphilosophien ein, wenn auch sicherlich nicht in die der rationalistischen Ausrichtung im Fahrwasser eines Descartes. Peter Wust stellt ein wesentliches Paradigma der Existenzphilosophie heraus, wenn er ihren Leitgedanken wie folgt formuliert: „Man wähle, so sage ich, den Menschen als Ausgangspunkt der Philosophie.“22 Diese eminente Fokussierung auf den Menschen als Instanz von Subjektivität impliziert tiefgreifende metaphysische, erkenntnistheoretische, anthropologische und ethische Kehrtwenden, die uns vor allem bei Kierkegaard und seiner Anbindung der Wahrheit an die Sphäre der Subjektivität begegnen werden. Dem Menschen wird somit wahrhaft eine metaphysische Bedeutung zugesprochen, da er in der Philosophie des Dänen zum Maßstab von Sein, Wahrheit und Stifter von Sinn wird;23 der Mensch wird zum ‚Schlüssel‘, um Heinemanns Formulierung wieder aufzugreifen. Dieses Kierkegaardsche Wahrheitsverständnis ist auch schon für Karl Jaspers ein Grundzug, der allen Existenzialisten gemeinsam sei und „die Rückkehr aus einer Wahrheit, die nur gedacht wird als das andere, dem gegenüber ich selbst gleichgültig bin, zur Wahrheit, die gelebt wird, zum Ernst, der im Menschsein liegt, das frei ist und über sich selbst zu entscheiden hat“,24 darstelle.
Jonathan Webber verfolgt in seinem 2018 erschienenen Buch mit dem programmatischen Titel Rethinking Existentialism den Anspruch, unter Rekurs auf de Beauvoir und Sartre ein neues Konzept existenzialistischen Denkens zu entwerfen. Der ,klassische‘ Existenzialismus seinerseits sei mit de Beauvoir und Sartre auf zwei zentrale Punkte zu bringen: den Grundsatz der Vorrangigkeit der Existenz vor der Essenz sowie die daraus resultierende Ethik, die zugleich an einem „moral imperative and strong eudaimonist reasons to respect human freedom“25 festhalte.
Diese wenigen Beispiele offenbaren, dass die Versuche, die Existenzphilosophie zu definieren und zu typisieren, unterschiedliche Ergebnisse zutage fördern, selbst wenn einige Sujets und Leitmotive wiederholt auftauchen. So zum Beispiel der von Sartre zum Grundsatz des Existenzialismus auserkorene Primat der Existenz vor der Essenz, den Steven Crowell als das Merkmal der Existenzphilosophie schlechthin beschreibt,26 und der Sartres Vortrag, „Ist der Existenzialismus ein Humanismus?“, quasi zu einem ,Manifest‘ des Existenzialismus erhebt. Die Sartre-Biographin Annie Cohen-Solal spricht gar von einer „existentialistische[n] Bibel“.27 Von einem allgemein anerkannten Katalog grundlegender Merkmale der Existenzphilosophie ist die Forschung jedoch weit entfernt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Existenzphilosophie somit einer klassischen lexikalischen Definition zu entziehen scheint, intendieren beispie...