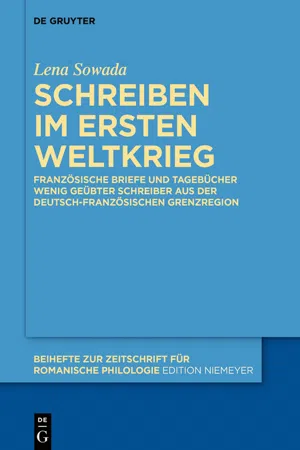
eBook - ePub
Schreiben im Ersten Weltkrieg
Französische Briefe und Tagebücher wenig geübter Schreiber aus der deutsch-französischen Grenzregion
- 663 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Schreiben im Ersten Weltkrieg
Französische Briefe und Tagebücher wenig geübter Schreiber aus der deutsch-französischen Grenzregion
Über dieses Buch
What shape does written language usage take in the diaries and letters of people with little routine or experience in writing? This volume looks at the geopolitical and historical context, the acquisition of written language and individual writing socialisation in order to examine this kind of writing on various linguistic levels as the expression of a heterogenous range of writing skills and different written language usage norms.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Schreiben im Ersten Weltkrieg von Lena Sowada im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Deutsch. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Über einhundert Jahre sind seit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs vergangen. Die Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrags jährte sich 2019 zum 100. Mal. Diejenigen, die diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts1 miterlebt haben, sind uns längst nur noch in Erinnerungen und Erzählungen, aber auch in geschriebenen Texten präsent. Viele Erfahrungen wurden in Briefen und Tagebüchern festgehalten, die uns heute ausschnittartig einen Zugang zur Realität des Ersten Weltkriegs ermöglichen.
Für weite Teile der Bevölkerung bedeutet der Erste Weltkrieg einen gravierenden Umbruch in der gewohnten Lebenswelt. Die Männer werden zum Militär eingezogen und an die Front geschickt oder zum Arbeitseinsatz abkommandiert. Sie verlassen ihre Familien, ihr gewohntes Umfeld und ihren Arbeitsplatz. Die Frauen müssen oftmals Aufgaben ihrer Männer übernehmen und sich um Haus und Hof kümmern. Das einzige Mittel, das ihnen bleibt, um den Kontakt aufrechtzuerhalten, ist das Schreiben. Während der beinahe fünf Jahre dauernden Kriegshandlungen werden unzählige Briefe, Postkarten und Päckchen versandt, die nicht nur die materiellen Bedürfnisse der Soldaten stillen, sondern auch und insbesondere eine psychische Stütze sind. Von 1914 bis 1918 werden Millionen von Briefen und Postkarten redigiert, von der Front in die Heimat und von dort an die Front, in denen sich die Schreiber2 ihrer guten Gesundheit versichern, den bisweilen lähmenden Alltag in den Schützengräben während des Stellungskriegs beschreiben, in denen die Entwicklung der Kinder und alltägliche Anekdoten berichtet, aber auch Informationen über gefallene Familienmitglieder, Bekannte und Freunde weitergegeben sowie Nachfragen formuliert und Hoffnungen ausgedrückt werden. Um den Grausamkeiten des Kriegs zu begegnen und ihnen wenigstens ansatzweise etwas entgegensetzen zu können, beginnen viele Soldaten ihre Erlebnisse in Tagebüchern festzuhalten.
Der Krieg betrifft alle und so greifen nun auch Menschen zu Stift und Papier, die in ihrem Vorkriegsalltag kaum mit dem Schreiben in Berührung kommen. Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive sind diese Schriftstücke von besonderem Wert, bilden sie doch den sprachlichen Ausdruck von denjenigen Mitgliedern einer Gesellschaft ab, die in der Geschichte eher wenig schriftliche Spuren hinterlassen haben. Aus dieser Perspektive ist der Erste Weltkrieg nicht nur ein historisch-politisches Ereignis, sondern auch ein kommunikatives.3
Die vorliegende Arbeit widmet sich eben diesen Menschen und ihrem sprachlichen Ausdruck. Sie versteht sich als ein Beitrag zur Sprachgeschichtsschreibung des Französischen, der den informellen Sprachgebrauch eines Ausschnitts der französischen Bevölkerung in den Jahren 1914 bis 1919 auf Grundlage authentischer, noch nicht untersuchter Textzeugnisse in den Blick nimmt. Die Autoren der Ego-Dokumente des Analysekorpus sind keine prominenten Persönlichkeiten oder politisch einflussreichen Akteure, sie sind Arbeiter, Handwerker und Landwirte aus zumeist einfachen Verhältnissen.
Diese Untersuchung der Ego-Dokumente legt den Fokus auf das sprachlich handelnde Individuum in einem spezifischen Kontext, unter dem Einfluss verschiedener historischer, sozialer und politischer Faktoren. Der theoretische Rahmen der historischen Soziolinguistik zielt darauf ab, Korrelationen zwischen sprachlichem Ausdruck und sozialen Variablen in einer gegebenen Sprachgemeinschaft aus historischer Perspektive zu etablieren. In einem ersten Schritt wird daher die historische Soziolinguistik in ihrer konzeptionellen und methodologischen Ausrichtung skizziert (Kapitel 2). Innerhalb dieses Rahmens des historisch-soziolinguistischen Zugriffes sind für die vorliegende Arbeit insbesondere die Konzepte der Sprachgeschichte «von unten» und des die Schreiber betreffenden Charakteristikums der peu lettré relevant.
Die Bezeichnung der Texte des Analysekorpus als Ego-Dokumente macht eine weitere theoretische Fundierung nötig (Kapitel 3). Das Konzept Ego-Dokument wird in seiner Herausbildung in der geschichtswissenschaftlichen Forschung sowie in seiner methodologischen und konzeptionellen Entwicklung vorgestellt. Ausgehend von seiner Anwendung in neueren sprachwissenschaftlichen Arbeiten wird das Konzept in dem für die vorliegende Arbeit relevanten Verständnis definiert. Außerdem werden die das Analysekorpus konstituierenden Texte in ihrer nähesprachlichen Affinität beschrieben.
In Kapitel 4 wird die Komposition des Korpus, das die Grundlage für die folgenden drei Analysekapitel 5 bis 7 bildet, geschildert. Hier werden zum einen in synthetischer Form die primären Schreiber der verschiedenen Textfonds vorgestellt und zum anderen die verschiedenen Phasen der Konstitution des Korpus sowie die Kriterien der Selektion der aufgenommenen Texte erläutert.
Die erste Analyse untersucht den schriftsprachlichen Ausdruck der weniger geübten Schreiber des Korpus auf den sprachlichen Ebenen der Orthographie, des Lexikons, der Morphosyntax und der diskursiven Organisation (Kapitel 5). Der individuelle Schriftsprachausdruck wird hierbei sowohl aus dem Blickwinkel des Schriftspracherwerbs mit seinen verschiedenen konstitutiven Phasen als auch aus der Perspektive einer Schreibsozialisation innerhalb einer sprachlichen Gemeinschaft beschrieben. Unter Berücksichtigung von am Schriftspracherwerb beteiligten mentalen Prozessen wird die Analyse um eine kognitive Dimension bereichert. Diese Analyse fragt nach den Motivationen für die von den Schreibern gewählten Varianten sowie den Strategien, die die Schreiber bei der Verschriftlichung mobilisieren.
Der geographischen Ausrichtung des Korpus ist die zweite Analyseperspektive geschuldet, die den in einem Ausschnitt der Texte dokumentierten Sprachkontakt zwischen dem Französischen und dem Deutschen und in geringerem Ausmaß auch des Französischen mit dem Italienischen und dem Englischen untersucht (Kapitel 6). Die Texte der zweisprachigen Schreiber bilden kontaktinduzierte Formen aus einer historischen Perspektive medial schriftlich ab.
Neben orthographischen, lexikalischen und morphosyntaktischen Kenntnissen müssen die Schreiber des Analysekorpus bei der Redaktion der Briefe über textsortenspezifisches Wissen verfügen. Die Modellierung dieses Wissens und die Auswertung des formelhaften Sprachgebrauchs bilden den Gegenstand des dritten Analysekapitels (Kapitel 7).
Die vorliegende Untersuchung erhebt keinen Anspruch auf statistische Repräsentativität und auch nicht darauf, den Sprachgebrauch bestimmter sozialer Gruppen exhaustiv abzubilden.4 Dies liegt jedoch auch nicht im Ziel der Analysen. Vielmehr zielt diese Betrachtung des Sprachgebrauchs weniger geübter Schreiber darauf ab, den schriftsprachlichen Ausdruck dieser Personen systematisch und in seinem sozio-historischen Kontext zu analysieren. Diese Arbeit versteht sich als eine Momentaufnahme des Schriftsprachgebrauchs eines Teils der Französischsprechenden und gewissermaßen als ein Stein in einem großen Mosaik der französischen Sprachgeschichte. Gemeinsam mit anderen Steinen soll sie dazu beitragen, ein ganzheitlicheres Bild der Geschichte des Französischen in seiner sozialen, stilistischen und regionalen Vielfalt zu zeichnen.
2 Historische Soziolinguistik und Sprachgeschichtsschreibung
2.1 Der Forschungsansatz der historischen Soziolinguistik
Das Konzept der historischen Soziolinguistik wurde in den 1980er Jahren aus dem Paradigma der Soziolinguistik heraus als eine Idee «which should fundamentally be possible» (Willemyns/Vandenbussche 2006, 146) entwickelt.
Als wegweisende Arbeit in der methodologischen und praktischen Etablierung der historischen Soziolinguistik wird gemeinhin Romaines Socio-Historical Linguistics (1982) angeführt, in der die entscheidende Verbindung von historischer Linguistik und Soziolinguistik verfestigt wird (cf. auch Conde Silvestre 2007, 32; Conde Silvestre/Hernández Campoy 2012, 1; Willemyns/Vandenbussche 2006, 146). Romaines Forschungsziel besteht in der Verschränkung beider Disziplinen in einem sozio-historischen sprachwissenschaftlichen Ansatz, der sprachliche Variation in ihren unterschiedlichen Ausprägungen und in ihrer Entwicklung in einer bestimmten Sprachgemeinschaft im Laufe der Zeit untersucht und erklärt (Romaine 1982, x).
Der Terminus historische Soziolinguistik wird zum ersten Mal 1987/88 im von Ammon, Dittmar und Mattheier herausgegebenen Handbuch Soziolinguistik erwähnt, obwohl bereits zuvor historische soziolinguistische Studien angefertigt werden (Willemyns/Vandenbussche 2006, 146).
Die historische Soziolinguistik ist eigentlich keine radikal neue Disziplin, sie wird ausgeübt, seitdem sich die Forschung mit Sprachgeschichte und mit den Interaktionen von Sprache als System und der Sprachgemeinschaft, in der sie ausgeübt wird, beschäftigt (Mattheier 1999, 1; Nevalainen/Raumolin-Brunberg 2012, 23). Historizität ist bereits in Labovs ersten soziolinguistischen Studien angelegt, da er sich in seiner Argumentation auf die historische Dimension bezieht. Eine historische Perspektive ist gleichfalls in soziolinguistischen Studien, die sich mit aktuellen Sprachständen befassen, präsent, da vielfach die aktuelle Situation einer Varietät oder einer Variable als Teil einer soziolinguistischen Entwicklung begriffen wird (Mattheier 1999, 1). Ähnlich wie Mattheier sieht auch Conde Silvestre (2007, 31) die Ursprünge der historischen Soziolinguistik bereits in früheren soziolinguistischen Arbeiten angelegt und betrachtet den Artikel Empirical Foundations for a Theory of Language Change (1968) von Weinreich, Labov und Herzog als eine der begründenden Forschungsarbeiten der historischen Soziolinguistik. Diese Studie korreliert Sprachwandelprozesse durch Beobachtung und Beschreibung der geordneten Heterogenität, die lebenden Sprachen inhärent ist, mit sozialen Variablen (Weinreich/Labov/Herzog 1968, 99–101 und 188). Wenngleich Variabilität nicht zwangsläufig zu Sprachwandel führt, impliziert jeder Sprachwandel synchrone Variation oder Heterogenität in einer Sprachgemeinschaft (Weinreich/Labov/Herzog 1968, 188). «A basic premise of historical sociolinguistics is that language is both a historical and social product, and must therefore be explained with reference to the historical and social forces which have shaped its use» (Romaine 2005, 1696).
In den 30 Jahren nach Romaines Veröffentlichung (1982) reift die Disziplin der historischen Soziolinguistik, sowohl in Bezug auf die theoretische Präzisierung des Untersuchungsfeldes als auch hinsichtlich der Anwendung von methodischen Grundsätzen und Resultaten der aktuellen Soziolinguistik auf historische Daten. Dadurch wird der Fokus der Disziplin erweitert, sodass nicht mehr nur Variation und Sprachwandel Gegenstand historisch soziolinguistischer Untersuchungen sind, sondern ebenso Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Sprechereinstellungen oder auch Standardisierung (Conde Silvestre/Hernández Campoy 2012, 1).
Zwischen Soziolinguistik und historischer Soziolinguistik besteht demzufolge eine enge wechselseitige Beziehung. Der Transfer soziolinguistischer Methoden, die für zeitgenössische Situationen entwickelt wurden, auf vergangene Sprachstände trägt zur historischen Rekonstruktion einer Sprache in ihrem sozialen Kontext bei. Einem Pendel ähnlich wird die historische Realität wiederum auf die aktuelle projiziert und kann so das Verständnis von im Prozess begriffenem Sprachwandel erhellen, wodurch die historische Soziolinguistik zu einem generellen Verständnis von Sprachwandel beiträgt (Conde Silvestre 2007, 34). Mattheier sieht die Differenz lediglich in den jeweils untersuchten Daten: «La ‹sociolinguistique historique› ne se distingue pas de la sociolinguistique contemporaine par sa méthodologie théorique mais par ses bases de données» (Mattheier 1999, 2). Die simultane Konzeption von synchroner und diachroner Untersuchungsperspektive unterstützt auch Aitchison (2012, 19), wenn sie schreibt: «diachrony and synchrony are not irreconcilable. They are essentially overlapping processes, and one cannot be understood without the other».1
Die Dominanz methodischer und methodologischer Herausforderungen in der Diskussion der historischen Soziolinguistik bis in die frühen 2000er Jahre stellt heraus, dass es sich um eine noch sehr junge Disziplin handelt (Willemyns/Vandenbussche 2006, 146). Zugleich sind die in dieser Zeit entstehenden international sichtbaren Studien im Wesentlichen auf das Englische und das Deutsche beschränkt. Studien zu anderen Sprachen werden zwar angefer...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- 1 Einleitung
- 2 Historische Soziolinguistik und Sprachgeschichtsschreibung
- 3 Ego-Dokumente: Konzept und Anwendung
- 4 Beschreibung des Analysekorpus
- 5 Variation im schriftsprachlichen Ausdruck
- 6 Sprachkontakt
- 7 Epistoläre Kommunikation
- 8 Exemplarischer Vergleich zweier Schreiberbiographien
- 9 Zusammenführung und Ausblick
- Register