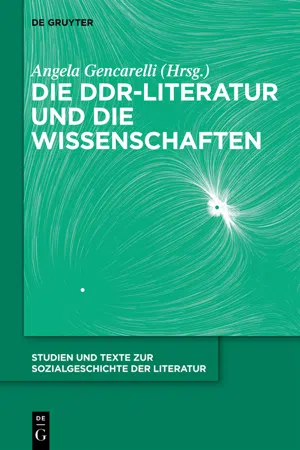1 Vorbemerkungen
Nahezu alle Handlungsstränge in Dieter Nolls 1979 erschienenem Roman Kippenberg sind vor dem Hintergrund eines wichtigen wissenschaftspolitischen Umbruchs in der DDR angesiedelt, der 4. Hochschulkonferenz im Februar 1967. Diese Konferenz zielte auf eine umfassende Neustrukturierung aller Bildungsinstitutionen im Land. Im universitären Bereich sollte der von ihr angeregte Reformprozess die Auflösung tradierter Institutsgrenzen zugunsten interdisziplinär arbeitender Forschungsgemeinschaften zur Folge haben. Der titelgebende Protagonist in Nolls Roman, Dr. rer. nat. habil. Joachim Kippenberg, leitet eine Arbeitsgruppe im fiktiven Berliner Institut für biologisch aktive Stoffe, das sich der Erforschung biologisch aktiver, d. h. pharmazeutisch nutzbarer Stoffe widmet. Kippenbergs Arbeitsgruppe ist als Prototyp eines solchen Forschungskollektivs angelegt. Innerhalb der Diegese nimmt diese Arbeitsgruppe damit lange vor der tatsächlichen Umsetzung der geplanten Hochschulreform deren Kerninhalte vorweg,1 denn in ihr arbeiten Mediziner, Chemiker, Biologen, Mathematiker, aber auch Wirtschaftswissenschaftler und Informatiker an gemeinsamen Projekten mit Vertretern produzierender Unternehmen. Insbesondere die Einbindung der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik verweist zudem auf weitere Umbrüche in der Wissenschaftsgeschichte der DDR, nämlich die Etablierung der Systemverfahrenstechnik als Querschnittsdisziplin sowie den Einsatz von Großrechnern in der naturwissenschaftlichen Grundlagen- und Anwendungsforschung.
Der Roman bilanziert diese wissenschaftspolitischen und -geschichtlichen Umbrüche in doppelter Weise: Zum einen arbeitete Noll offenbar bereits seit Ende der 1960er Jahre an seinem Text2 und hatte so die Möglichkeit, die historischen Auswirkungen der von ihm literarisch aufgearbeiteten Reformen zu beobachten. Zum anderen spiegelt sich diese historische Beobachtungsdistanz in der Gestaltung der Erzählperspektive, denn der autodiegetische Erzähler Joachim Kippenberg berichtet über das im Februar 1967 Erlebte und seine damit verbundene Schaffens- und Existenzkrise mit einem zeitlichen Abstand von etwa einer Dekade. Dennoch wurde der Roman von der zeitgenössischen Literaturkritik in der DDR mitunter als großer Gesellschaftsroman der Gegenwart charakterisiert.3 Einige LiteraturkritikerInnen stellten allerdings auch heraus, dass zwischen der Zeitebene 1967, in der die histoire des Romans angesiedelt ist und der Zeitebene 1977, der Gegenwart des sich erinnernden Kippenberg, kaum erkennbare Bezüge hergestellt werden. Tatsächlich ist der historische Abstand des Erzählers zum Erzählten deutlich zu erkennen; über seine eigene Gegenwart hingegen gibt dieser Erzähler jedoch kaum etwas preis. Eine Rahmenhandlung im eigentlichen Sinne ist also nicht vorhanden. Es scheint so, als ob das schon im Klappentext der Originalausgabe ins Zentrum gerückte Thema des Romans, die kritische Reflexion der eigenen Persönlichkeit und Bilanzierung des eigenen Fortschritts, nicht konsequent zu Ende erzählt werde. Vielmehr verbleibt Kippenberg als sich entwickelnde Figur wie Erzähler lediglich bei der Ankündigung von wahrlich neuen Entwicklungen: eines revolutionären Syntheseverfahrens samt des Baus einer zugehörigen Pilotanlage im Eilverfahren; der Einführung eines neuen, kollektiven Arbeitsstils im Institut für biologisch aktive Stoffe in Berlin; eines „von Grund auf umgekrempelt[en]”4 Joachim Kippenberg. Die tatsächliche Umsetzung all dieser Innovationen bleibt jedoch unerzählt. Mehr noch: Der Erzähler des Jahres 1977 suggeriere, so zumindest der Tenor einiger zeitgenössischer RezensentInnen, durch die Auslassung der konkreten Realisierung all dieser angekündigten Neuanfänge in der Erzählung, sie hätten sich problemfrei vollzogen. Eine „dialektische Sicht auf unser Heute”5 werde so jedenfalls nicht ermöglicht. Kippenberg sei damit gerade kein moderner und seiner Gegenwart entsprungener Text, sondern vielmehr „ein traditioneller Roman mit einer Figurenkonstellation und Konfliktgestaltung der fünfziger Jahre und einer miserablen Sprache, die nicht mehr in unsere Literaturlandschaft passe.”6 Für Gerd Labroisse ist die weitgehend fehlende Rahmenhandlung der blinde Fleck des Romans, seine „Konzeptions-Schwäche[] (oder sogar -Fehler)”7, denn es sei nicht erkennbar, welche Funktion die zusätzlich eingezogene Zeitebene für die Erzählung überhaupt habe.
Unabhängig von den vermeintlichen Schwachstellen, die die zeitgenössische Literaturkritik am Roman aufgedeckt zu haben meint, kann es aber als unbestritten gelten, dass Noll seinen Kippenberg vor der Folie der angedeuteten wissenschaftsgeschichtlichen und -politischen Reformen als einen Roman über das Bilanzieren und das Neuanfangen angelegt hat. Seine Rückgriffe auf eine „Figurenkonstellation und Konfliktgestaltung der fünfziger Jahre” erscheinen mir jedoch weniger Symptom eines für die 1970er Jahre archaischen Literaturverständnisses zu sein als vielmehr ein bewusster Rückgriff auf Form- und Strukturmerkmale der Aufbauliteratur sowie – und daraus erklärt sich die Zentrierung des Begriffs ‚Anfang‘ im Titel dieses Beitrags – auf den für viele frühe Werke der Aufbauliteratur obligatorischen Topos des ‚schweren Anfangs‘. Die damit verbundenen literarhistorischen Muster und Motive werden von Noll in einer auf die Gegenwart der späten 1960er Jahre verweisenden Aufbauerzählung reaktualisiert, nicht ohne den der historischen Aufbauliteratur inhärenten Anspruch auf Darstellung des gesellschaftlich Neuen gleichermaßen auch zu problematisieren. Anlass für diese Deutung geben die zahlreichen Verweise auf die Nachkriegs- und Trümmerzeit, in der der Protagonist, selbst Arbeiterkind, den Anfang für seinen beruflichen Werdegang zum Spitzenforscher verortet, ebenso wie Anleihen an typische Darstellungsmuster der literarhistorischen Vorlage ‚Aufbauliteratur’.
Der hochschulpolitische und wissenschaftsgeschichtliche Umbruch und Neuanfang 1967 wird – so meine These – in Kippenberg mit gängigen Erzählmustern der Aufbauliteratur inszeniert und zugleich in seiner gesellschaftlichen Funktionalisierung kritisch hinterfragt, denn die als Leerstelle inszenierte Rahmenhandlung sowie die Erzählperspektive im Roman unterlaufen das, was man vordergründig für die Darstellungsabsicht des Romans halten könnte: den sich problemfrei vollziehenden Wandel zu einem besseren und international konkurrenzfähigem Hochschul- und Wissenschaftssystem in der DDR. Der vermeintliche blinde Fleck innerhalb der Diegese lässt – sofern man ihn nicht als Kompetenzschwäche des Autors Dieter Noll auslegt – zwei alternative Deutungsoptionen zu. Eher unwahrscheinlich ist die folgende: Der Kippenberg des Jahres 1977 hat bereits den Idealzustand eines sozialistischen Wissenschaftlers erreicht und schlicht keine beruflichen oder persönlichen Probleme mehr, über die es noch zu reflektieren gelte. Oder aber: Die ausschließlich auf die Vergangenheit, aber nicht auf die Gegenwart des Erzählers gerichtete kritische Selbstreflexion erzeugt eine produktive Leerstelle im Text. Deren Funktion gilt es anhand einer Rekonstruktion verschiedener Inszenierungen des Neuanfangs um 1967, wie der Roman sie anbietet, nachzuspüren. Zu diesem Zweck werden, erstens, der hochschulpolitische Neuanfang im Zuge der 4. Hochschulkonferenz und zweitens, der wissenschaftsgeschichtliche Neuanfang, den der Großrechnereinsatz in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und die Etablierung der Systemverfahrenstechnik als Querschnittdisziplin mit sich brachten, in den Blick genommen. Diese Prozesse werden in den folgenden beiden Kapiteln sowohl in ihrem historischen Ablauf als auch in ihrer literarischen Inszenierung vergleichend untersucht. Die in Kippenberg literarisch vorgenommene Bewertung dieser Neuanfänge ist jedoch nur zu erfassen, wenn, drittens, auch ihre Kontextualisierung durch narrative und strukturelle Muster im Stil eines Aufbauromans in den Blick genommen wird. Durch diese Kontextualisierung stellt sich Kippenberg, ein Roman über einen wissenschaftspolitischen Umbruch- und Reformprozess in den späten 1960er Jahren, in die Tradition des zu diesem Zeitpunkt bereits historischen Genres der Aufbauliteratur, das sich poetologisch über die Inszenierung eines gesamtgesellschaftlichen Neuanfangs definiert.
2 Neuanfang hochschulpolitisch: Die Reformierung des DDR-Hochschulwesens im Zuge der 4. Hochschulkonferenz 1967
Eine systematische und historisch breite Aufarbeitung der gesamten hochschul- bzw. wissenschaftspolitischen Entwicklung der DDR stehe bisher aus, stellt Andreas Malycha fest,8 der für die Jahre 1945 – 1961 eine kommentierte Ausgabe bedeutsamer wissenschaftspolitischer Dokumente aus der DDR verantwortet hat.9 Auch deswegen muss die folgende Betrachtung der hochschulgeschichtlichen Entwicklungen, vor deren Hintergrund das Romangeschehen von Kippenberg angesiedelt ist, lückenhaft bleiben. Ihr Fokus liegt auf dem wichtigsten wissenschaftsgeschichtlichen Referenzpunkt im Roman, der 4. Hochschulkonferenz in Berlin vom 2. und 3. Februar 1967; die Romanhandlung selbst setzt nur wenige Stunden vorher, am Nachmittag des 1. Februar, ein und nimmt die anstehende Konferenz zum Anlass, die Konfliktlinien in Kippenbergs Arbeitsumfeld offenzulegen, die „nicht nur die Konfrontation zweier Forschungsstile […], sondern auch die zweier grundverschiedener Auffassungen von Sinn und Zweck der Wissenschaft” (KB, S. 232) abbilden. Die in diesem Sinne semantisch aufgeladene Unterteilung des Instituts in Alt- und Neubau wird auch auf figuraler E...