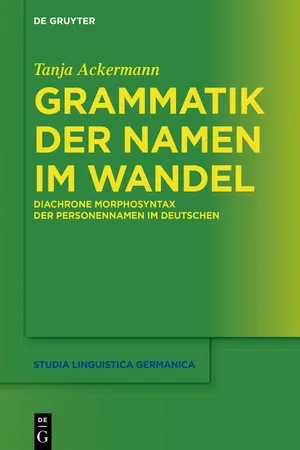1.1Gegenstandsbereich und Ziel der Arbeit
Im Fokus dieser Arbeit stehen Eigennamen. Im Gegensatz zu anderen, vorwiegend diachron ausgerichteten onymischen Studien werden hier jedoch nicht Probleme der Etymologie oder der Namengeschichte ins Zentrum des Erkenntnisinteresses gerückt. Auch die semantische Unterscheidung zwischen Appellativen und Eigennamen, die in den letzten Jahren sowohl in der Sprachwissenschaft als auch in der Philosophie ausführlich diskutiert wurde, bildet nicht den Schwerpunkt dieser Arbeit. Es soll hier vielmehr die synchrone und diachrone onymische Grammatik – speziell die Morphologie und (Morpho-)Syntax – in den Blick genommen werden. Bislang hat die theoretische Linguistik den Eigennamen keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt und sie somit oft wie den „poor cousin“ anderer grammatischer Kategorien behandelt, wie Van Langendonck (2007: 2) in der Einleitung seiner primär sprachwissenschaftlich orientierten Monographie zu Eigennamen anmerkt. Das sich in diversen zur Zeit stattfindenden Workshops und neu erscheinenden Sammelbänden widerspiegelnde, aktuell aufkommende Interesse an den explizit grammatischen Eigenschaften von Eigennamen zeigt, dass aus synchroner, diachroner und typologischer Perspektive bislang noch viele Forschungsfragen unbeantwortet sind.1
Die vorliegende Arbeit macht es sich nun zum Ziel, das auf dem funktionalen Sonderstatus basierende morphosyntaktische Verhalten von Eigennamen im Deutschen aus diachroner und synchroner Sicht zu analysieren. Dabei liegt der Schwerpunkt ganz klar auf den Personennamen, die als die prototypischsten Vertreter dieser Klasse gesehen werden können (vgl. 2.2). Andere Namentypen werden aber immer wieder mit einbezogen und mit Personennamen kontrastiert.
Allen Namenarten gemein ist, dass sie im Gegenwartsdeutschen im Vergleich zu anderen Substantiven einige grammatische Unterschiede aufweisen, die in Kap. 2.1.2 noch ausführlich thematisiert werden sollen. Prominentes Beispiel für die spezielle Morphologie von Eigennamen ist ihre Minimalflexion: Der nahezu einzige Defaultmarker, der im Plural und in gemeinhin als genitivisch beschriebenen Konstruktionen2 – außer bei auf Sibilant endenden Namen – an den Eigennamen treten kann, ist das invariante -s (zwei Carinas, Carinas Schwester), das anders als im appellativischen Bereich nie in der silbischen Variante erscheint (Matthias’ Schwester statt Matthiasses Schwester versus die Schwester dieses Mann(e)s; vgl. z. B. Nübling & Schmuck 2010, Fuß 2011, Plank 2011 und Nübling 2012). Im nicht-onymischen Substantiv-Bereich herrscht – vor allem hinsichtlich der Pluralmarkierung – weit größere Allomorphie (vgl. z. B. Dammel & Gillmann 2014). Aus morphosyntaktischer Sicht ist bekannt, dass Eigennamen zur sogenannten Monoflexion tendieren – d. h. die Genitivanzeige erfolgt tendenziell nur einmal bzw. nicht-kongruierend innerhalb einer onymischen Nominalgruppe (die Hänge des Himalaya) –, während im nichtonymischen Bereich eher Polyflexion gilt (die Hänge des Hochgebirgssystems; vgl. z. B. Nübling 2005, 2012 oder Zimmer 2018). Was die Syntax der Eigennamen betrifft, wurde bereits rege die für bestimmte Namenklassen – wie die Personennamen im Standarddeutschen – geltende primäre Artikellosigkeit diskutiert, die für Appellative defaultmäßig nicht gilt (ich kenne _ Susi nicht vs. ich kenne die Frau nicht; vgl. z. B. Bellmann 1990, Kolde 1995, Gallmann 1997, Karnowski & Pafel 2005 und Longobardi 2005). Allein diese kurze Auflistung zeigt, dass Eigennamen im Gegenwartsdeutschen ein grammatisches Verhalten aufweisen, das sie von dem übrigen Substantivbereich unterscheidet. Dieses spezielle namengrammatische Verhalten soll in dieser Arbeit nun auch mit Blick auf seine diachrone Entwicklung detailliert beschrieben und empirisch fundiert erklärt werden.
Was die Diachronie der onymischen Morphosyntax betrifft, so ist aus der Forschungsliteratur bereits bekannt, dass Eigennamen ihre Sonderstellung im substantivischen Bereich erst in den letzten Jahrhunderten ausgebaut haben und grammatisch sukzessive von den Appellativen – aus denen Eigennamen primär entstanden sind – abdriften (vgl. z. B. Steche 1927: 140–152, Fuß 2011, Plank 2011 oder Nübling 2012). Umfassende Korpusstudien, die eine genaue zeitliche Einordung dieses Wandels und eine Bestimmung seiner Determinanten erlauben, sind jedoch bislang ein Desiderat, das Nübling (2012: 244) wie folgt formuliert: „Dass wir so wenig Genaues über seine Diachronie wissen, liegt daran, dass in den Darstellungen zur historischen Nominalflexion die Eigennamen bestenfalls in Fußnoten abgedrängt, in aller Regel jedoch gar nicht berücksichtigt werden“. Die vorliegende Arbeit nimmt es sich nun zum Ziel, offene Forschungsfragen hinsichtlich der Eigennamen-Morphosyntax empirisch zu beantworten und somit innerhalb der diachronen Nominalmorphologie eine Forschungslücke zu schließen, auf die bereits Steche (1925: 205) aufmerksam gemacht hat:
Die Eigennamen sind die einzigen Wörter der deutschen Sprache, die im 19. Jahrhundert eine tiefgreifende Umgestaltung erfahren haben; die übrige Sprache stimmt dagegen noch fast völlig mit derjenigen unserer großen klassischen Dichter überein. Diese Unterschiede bei den Eigennamen sind altbekannt, aber eine Erklärung findet man eigentlich nie [...].
Im Fokus dieser Arbeit stehen also die Beschreibung, Analyse und theoretische Erfassung der Entwicklung des morphosyntaktischen Verhaltens der Eigennamen, das immer wieder mit den Entwicklungen im übrigen substantivischen Bereich in Bezug gesetzt werden soll. Im Kern werden hier die paradigmatische Deflexion – sprich der Allomorphieabbau – und die syntagmatische Deflexion – sprich der Flexivabbau am Eigennamen – mit all ihren Auswirkungen auf die Nominalgruppe vom Frühneuhochdeutschen bis zum Gegenwartsdeutschen untersucht, wofür nun einige historische und gegenwartssprachliche Beispiele gegeben werden sollen.
Im Genitiv beispielsweise – so zeigen die in (1) aufgeführten Belege aus dem Deutschen Textarchiv (DTA) – herrscht innerhalb der onymischen Deklination noch im späten Frühneuhochdeutschen/frühen Neuhochdeutschen reiche Allomorphie. Neben den deutschen Flexiven -(e)n, -(e)ns und -s werden auch lateinische Deklinationsendungen wie -i oder -ae genutzt, um den Genitiv am Namen zu markieren.
Die syntagmatische Deflexion, die im postnominalen Genitiv bis heute fortwirkt und aktuell – mehr bei Toponymen und Ergonymen als bei Anthroponymen, die aktuell kaum noch Flexive aufweisen – einen Zweifelsfall darstellt, setzt ebenfalls erst im frühen Neuhochdeutschen ein, was die DTA-Belege in (2) exemplifizieren.
Auch die Pluralmorphologie, die sich nicht weniger stark gewandelt hat als die Kasusmorphologie (vgl. die historisch nachweisbare Allomorphie in (3)), stellt heute einen Zweifelsfall dar. So fragen sich vor allem TrägerInnen von auf /s/ endenden Namen häufig, wie man ihren Namen in den Plural setzt (vgl. die Korpusbelege aus dem synchronen Webkorpus DECOW2012 in (4)). Wie Beispiel (4a) zeigt, ist auch hier Monoflexion – sprich, die alleinige Pluralmarkierung am Begleitwort – eine Option.
| (4) | a. | er sah zwei Max |
| | [http://dev.nickstories.de/stories/hajo/Jan_oder_anders_anders-04.html] |
| b. | das Ergebnis unserer beiden Maxe (groß und klein) |
| | [http://www.golfclub-owingen.de/htdocs/de/0101_311.html] |
| c. | Wir laden alle Mäxe aus NRW dazu herzlich ein |
| | [http://yamaha-xmax.de/forum/archive/index.php/thread-680-2.html] |
Insgesamt, so wird in dieser Arbeit gezeigt, ist die Geschichte der onymischen Flexion stark durch Reduktion und Verlust geprägt. Mit dem -s hat sich im Singular jedoch ein Marker gehalten und auf alle – auch feminine – Eigennamen ausgebreitet (vgl. (5)). Dieser Marker tritt heute primär an pränominale onymische Possessoren und stellt ein interessantes Phänomen am Übergangsbereich von Morphologie und Syntax dar.
| (5) | a. | Sebastians neuer Kollege |
| b. | Claudias neuer Kollege |
Die Stellungsasymmetrie bei adnominalen Possessivkonstruktionen zeigt, dass Eigennamen auch aus syntaktischer Perspektive – die hier ebenfalls behandelt werden soll – ein interessantes namengrammatisches Untersuchungsobjekt darstellen: So gelten Eigennamen in Prästellung noch heute als voll akzeptabel (vgl. (6a)) und unterscheiden sich darin von den Appellativen, die zwar im Ahd. auch noch gewöhnlich vor ihrem Bezugsnomen standen, in dieser Position gegenwartssprachlich jedoch archaisch wirken und defaultmäßig hinter ihr Bezugsnomen treten (vgl. (6b)).
Ein Phänomen, das ebenfalls einen interessanten Fall am Übergangsbereich zwischen Syntax und Morphologie darstellt und dem bisher ...